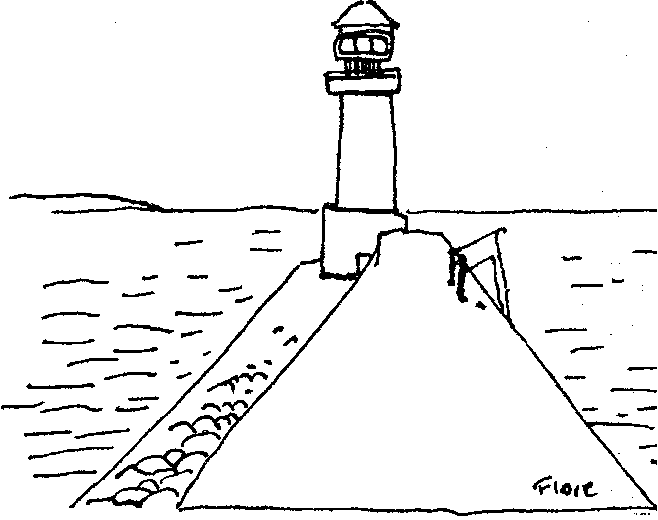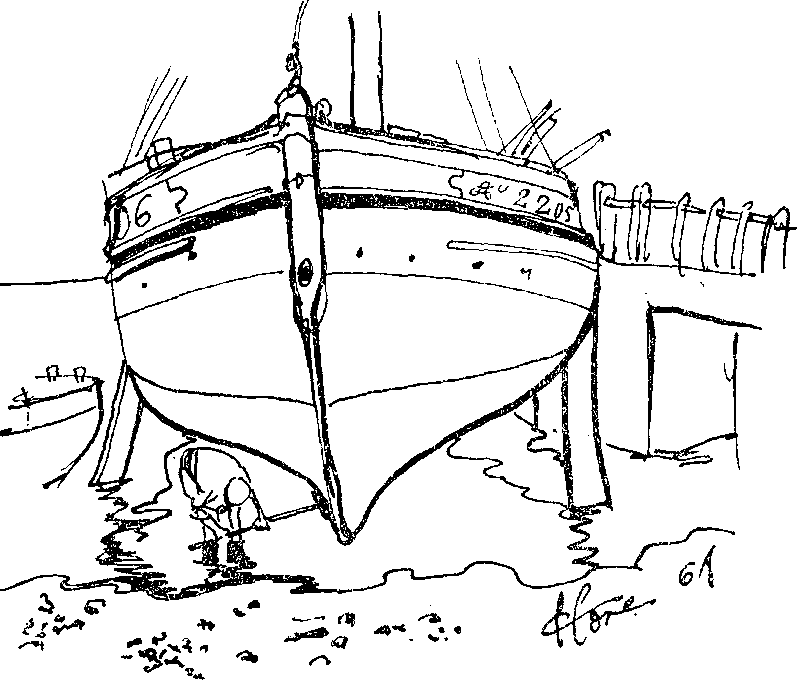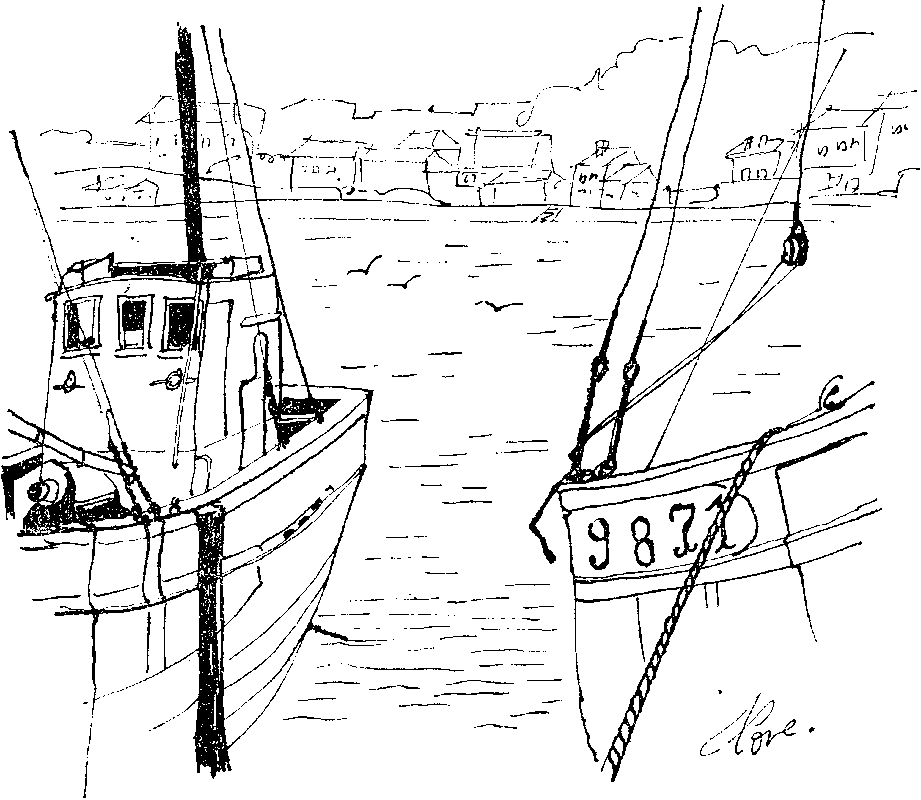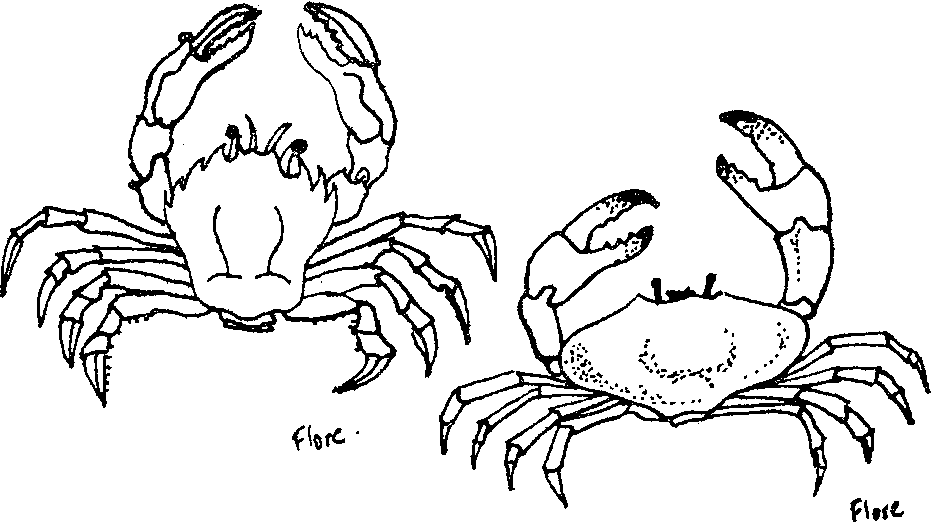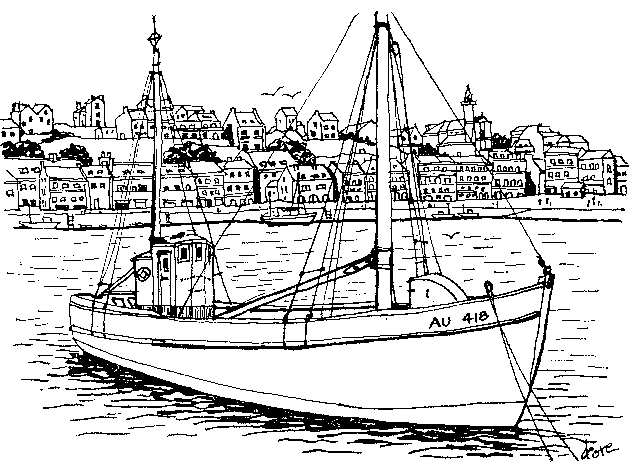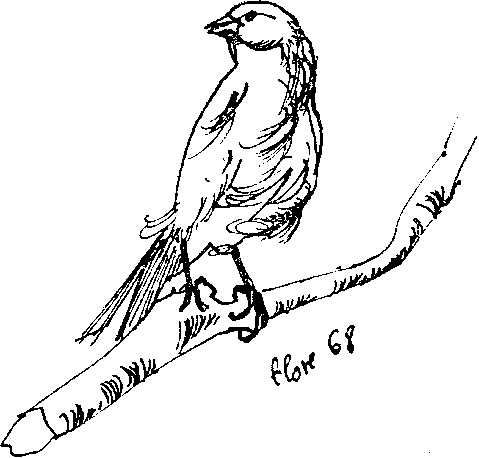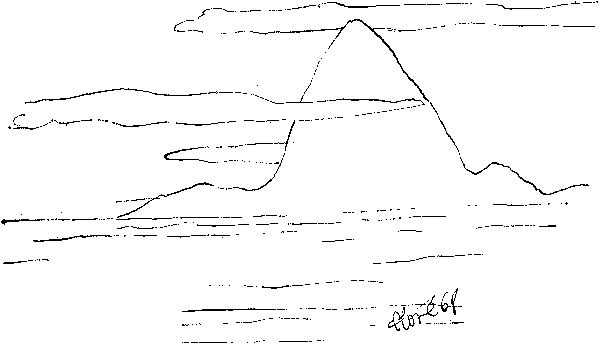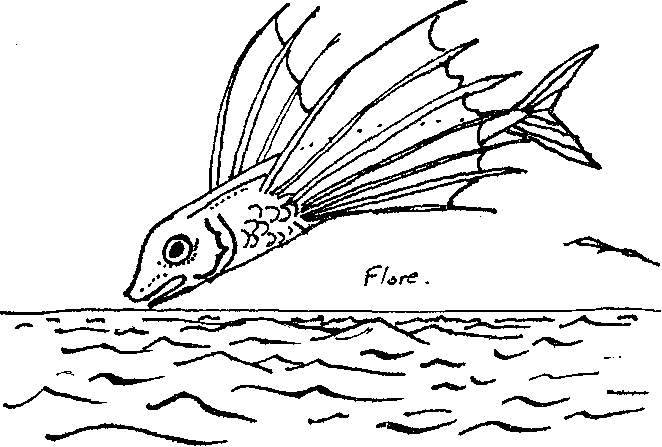Eine Reise nach Guyana
Audierne in der Bretagne
Vorwort
"Der Leser findet in diesem Büchlein den Bericht über eine eigenartige Seereise. Eine französische Familie wurde von Gott so geführt, ähnlich wie einst Abraham, Vaterland und Freundschaft zu verlassen und in ein fremdes Land zu ziehen, ohne sich dort vorher angemeldet oder irgendwie gesichert zu haben.
Sie kauften sich ein passendes Fischer-Motorboot, um damit samt ihrer Habe den Atlantischen Ozean zu überqueren mit dem Ziel Cayenne in Guayana.
Der Bericht ist von der Mutter, namens Esther, verfasst. Ray ist der Rufname des Vaters. Die sechs Kinder, lauter Mädchen im Alter von 4 - 22 Jahren, machten die Reise mit, wobei sich die Älteren besonders tatkräftig erwiesen.
Es ist herzerquickend zu lesen, wie Gottes Liebe und Treue sich zu diesem Glaubenswagnis bekannte und wie seine väterliche Fürsorge auch bei der Ankunft schon alles für ihre weitere Zukunft vorbereitet hatte." E.B
4. Juni 1968
Heute sind wir den vierten Tag auf unserem Schiff. Es ist jetzt fünf Uhr abends. Auf dem Gasherd steht ein großer Topf mit Karotten und Kartoffeln, gewürzt mit etwas Thymian. Wenn alles weichgekocht ist, tun wir noch eine Büchse grüne Erbsen dazu. Dies gibt ein kräftiges Nachtessen, an dem jeder seinen Hunger stillen kann. Hunger haben wir alle, nicht nur von der appetitanregenden Seeluft, sondern auch von der ungewohnten ununterbrochenen Arbeit, die das Saubermachen, Anstreichen und Einrichten des Schiffes mit sich bringt.
Ray brachte heute viele Bretter und Stangen an den Küchenwänden an für Teller, Tassen, Besteck und alles, was man braucht. Er hat sie in einer Weise festgemacht, dass alles unbeweglich bleibt, wenn das Schiff einmal zu schaukeln beginnt.
Seite 5
Ray ist ein unermüdlicher Erfinder, der für alle kleinen Dinge, die mir zu Problemen werden, einen richtigen Platz und eine gute Lösung findet.
Um die zwei großen Gasbrenner gehen zwei runde Eisenstangen.
Somit bleiben Kochtöpfe und Pfannen ruhig, auch wenn das Meer unruhig ist. Von einer Wand an die andere, gerade vor den zwei Gasbrennern, ist eine andere Eisenstange. Daran können wir uns festhalten beim Kochen, wenn wir einmal draußen sind im Meer.
7. Juni
Vor zwei Tagen kam ein freundlicher Mann an Bord und sagte, wir könnten Wasser bei ihm holen in seiner Fabrik, sie hatten eine Quelle. Das Haus ist gerade gegenüber von unserem Schiff. Dort dürfen wir jetzt Wasser holen, so viel wir wollen und auch unsere Wäsche schwenken. Wir sehen hierin die Hand des Herrn. Monsieur H., der Obengenannte, kommt mehrmals des Tages und spricht mit uns, wie wenn er ein altbekannter Freund wäre.
11. Juni
Wir sind jetzt etwas über eine Woche in Audierne, und wir sind alle braungebrannt von der Sonne und der Meeresluft. Das ist das erste, was einem auffällt, wenn man von der Großstadt hierher kommt: alle Leute, die hier wohnen, ob alt oder jung, haben diesen braunen Teint, der jedes ältere Gesicht verschönt. Die Fischer haben sogar ein rotbraunes Aussehen. Diese Farbe bekommen sie auf hoher See.
Am heutigen Sonntag machen wir einen kleinen Spaziergang, Ray und ich allein. Wir haben die Mädchen, Flore, Sylvia, Lydia, Agnès, Véronique und Johelle dem Schiff anvertraut.
Wir gehen in dem Hafen entlang. Jedes Schiff, das wir streifen, sehen wir uns genau an. Meistens stehen die „langoustiers“ (Langusten-Schiffe) hier. Die „thoniers“ (Thunfisch-Schiffe) sind zurzeit alle draußen beim Fischen. Wir hoffen, dass sie zurückkommen, solange wir noch hier sind, damit wir uns noch ein Thunfisch Gericht zubereiten können.
Endlich kommen wir an die große eiserne Brücke, die mit Holz schwellen bedeckt ist. Wir sind am Ende von Audierne. Vor uns liegt die Mole, und hinter ihr ist nur noch Himmel und Meer. Wir spürten schon, bevor wir um die Ecke kamen, die herrlich reine Luft, wie man sie nur draußen atmet. Jetzt sehen wir die wundervollen Farben: blau, blaugrün, weiter weg ein dunkleres Blau. Der Himmel spiegelt sich hier im Meer, und das Meer spiegelt den Himmel wider.
Seite 6
Das Auge kann sich nicht sattsehen an dieser Schönheit. Wer hat das Meer gemacht und alles was darin ist, und wer hat den Himmel gemacht und alles was darunter und darüber ist? "Du Herr!"
Ein kleines Fischerboot kommt von draußen und fährt an uns vorbei. Nur ein Mann ist an Bord. Er hält das Steuerrad. Hinter sich lässt er lange schräge Streifen im Fahrwasser. Trotz dem dumpfen Motorlärm liegt über der ganzen Atmosphäre eine tiefe Stille.
Diese kleinen Fischerboote fahren nur für einen Tag ins Meer hinaus, bringen aber meistens reichlich Fische mit heim beim Zurückkommen.
12. Juni
Unser Schiff heißt "Perle des Vagues", auf deutsch "Perle der Wogen". Es ist 17 Meter lang und 5,80 Meter breit und hat zwei Masten. Der Schiffsrumpf ist aus Eichenholz gebaut. Das ganze Schiff besteht aus vier Teilen:
Foto
1. Vorderposten: Acht Schlafstätten, zwei Bänke und ein Tisch, mit der Kettengrube an der vordersten Spitze.
2. Schiffsraum: Ungefähr 25 Kubikmeter isoliert, eigentlich ein Eiskeller, in welchem man 18 Tonnen Eis laden kann, um den Fisch während drei Wochen frisch zu erhalten.
3. Maschinenraum: Ein guter, ziemlich neuer Motor 120 PS. Die Behälter können 5500 Liter Brennstoff fassen.
4. Hinterposten: Fünf Schlafstätten, die Proviantkammer, zwei Bänke, ein Tisch. Ganz hinten zwei Wasserbehälter, die zusammen 1500 Liter Wasser fassen.
Seite 7
Auf dem Deck, etwas nach der Mitte: die Kommandobrücke, die Küche, der Abort.
Alle Fischer hier sind verliebt in dieses Schiff und können es nicht genug loben. Alle Stimmen, die wir dann und wann hören, laufen auf eines hinaus: Es hat den besten Motor von allen Schiffen im Hafen und es hält fest im Meer.
Manche denken, wir hätten dieses Schiff gekauft, um ein Vergnügungs-Schiff daraus zu machen. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Nachdem Ray nun sieben Jahre in einer chemischen Fabrik arbeitete, fünf Jahre in Paris und die letzten zwei Jahre in Brüssel, hier ganz abhängig von Amerika, entschlossen sich die Amerikaner, Ray's Büro, das den Bau neuer Fabriken entwarf, ganz aufzulösen und sämtliche Angestellten zu entlassen. Dadurch befanden wir uns in einer schwierigen Lage, und wir sannen darauf, ein Schiff zu kaufen. Nicht, dass wir einer Meer-Leidenschaft oder Reiselust nachgeben wollten, nein, am liebsten ist uns ein ganz ruhiger Ort. Dieses Schiff würde unser Brotverdienst sein in einem anderen Land, wo es nicht viele Schiffe gibt.
Wir dachten an Neu-Kaledoniern. Dort waren wir Vor 15 Jahren. Wir lebten damals auf einer der drei Korallen-Inseln, namens Lifou, und haben erlebt, wie selten ein Schiff ankam und von den wenigen, die existierten, gingen manche unter, weil sie viel zu viel überladen wurden.
Eines Nachts jedoch hatte Ray einen Traum: In demselben waren wir mitten im Atlantischen Ozean und wurden bedroht von einem Sturm. Um diesem zu entweichen, richteten wir das Schiff mehr nach Süden, und schließlich kamen wir wohlbehalten im französischen Guayana an.
Guayana? - Zuletzt hatten wir an dieses Land gedacht. Wir haben nie darüber gesprochen und es ist uns fast unbekannt. Wenn aber Gott unsere Aufmerksamkeit darauf lenkt, so hat Er sicher einen Grund. Und wenn wir es auch nicht verstehen, so gehen wir halt in dieses Land. Wir haben doch um Seine Führung gebeten.
Aber ist dies wirklich Sein Wille? Einen eigenen Weg wollen wir nicht gehen. Ray hat sich deshalb nicht gescheut, nach Deutschland zu fahren.
Seite 8
Dort fragte er Brüder um Rat, mit denen wir Geistesgemeinschaft haben, im Sinne des Urim und Thummim, wie auch Christian Röckle deutlich darüber schreibt in seinem Heft Nr. 12 "Der neue Tempel der Gemeinde". Der Bruder, mit dem Ray gleich am Abend seiner Ankunft sprach, fand unser Vorhaben gut; nichts sprach dagegen. Am andern Morgen kam er frühe wieder und sagte zu Ray: "Ich gebe dir meinen Segen für diese Unternehmung und eure Reise nach Guayana".
Ray fuhr wieder nach Brüssel zurück. Es kam dann so, dass die amerikanische Firma uns so reichlich entschädigte, dass wir "Perle des vagues" kaufen konnten. Auch bezahlten sie unsere Rückreise nach Frankreich nicht nur bis Paris, wie sie sollten, sondern bis Audierne.
Heute ist Springflut. Soeben verlässt ein grünes Thunfisch-Schiff den Hafen. Drei Sirenentöne und es fährt königlich hinaus, links und rechts am Vordermast die hohen Angelstangen, welche das Fischen des Thuns charakterisieren. Für drei Wochen geht es ins Meer, wie die anderen.
Es wird mir immer etwas wehmütig zumute, wenn ich ein Schiff ins Weite fahren sehe. Das Erdenleben und das Meerleben sind zwei verschiedene Welten, und wenn ein Schiff den Hafen verlassen hat, dann ist es in einer anderen Welt.
Ein alter Spruch kommt mir in den Sinn. Vor Jahren habe ich ihn von einem teuren bretonischen Freund erlernt:
Es gibt
die Lebendigen, die Toten
und diejenigen,
die ins Meer gehen.
Möwen sind sehr schöne, erhabene Tiere. Sie haben einen gelben Schnabel, ihr Federgewand ist weiß, ihre Flügel sind innen und außen grau, oft mit schwarzen Punkten an den Spitzen. Auch ihre Schwanzfedern haben einen schwarzen Rand. Mit großem Geschrei fliegen sie dann und wann über uns hinweg. Ihr scharfes Auge sieht von hoch oben die Fische unter dem Wasser.
Im Gleitflug lassen sie sich bei Ebbe auf den noch nassen Sand nieder. Aber auch hier entgeht ihnen nichts, auch wenn sie stille stehen, ist ihr Auge hell wach, und ihr Kopf ist stets in Bewegung, lauernd auf alles, was um sie her geschieht.
Lange Zeit kann ich sie beobachten, ohne mich zu langweilen.
Seite 9
Heute, Samstag, gehe ich mit Lydia auf den Markt. Er ist auf einem dreieckigen Platz, wobei eine Seite an den Hafen grenzt und sich noch weiter dem Kai entlang zieht. Obwohl Audierne keine große Stadt ist, ist es mir eine helle Freude, nach unserem zweijährigen Aufenthalt in Brüssel wieder einmal durch einen französischen Markt zu schlendern.
Die Bretagne ist das Land, wo die besten Gemüse wachsen wegen seinem milden Klima und ohne Zweifel auch wegen dem vie1en feinen Regen, mit dem es benetzt ist. Das hat besonders der Blumenkohl gern. Er ist hier die Krone der Gemüse. Nirgends gibt es solch schöne und große Blumenkohle. Ich kaufte den größten von dem der Händler sagte, er wiege 5 Pfund für 2 Franken. Davon werden wir alle satt werden.
Seite 10
Etwas weiter steht eine Kiste mit Gelberüben, hier Karotten genannt. Der Name "Gelbrübe" würde ihnen auch gar nicht stehen, denn ihre Farbe gleicht mehr einer Orange als einer gelben Rübe. Sie sind so groß und dick, dass oft zwei genügen für ein Pfund. Wenn man sie roh reibt, sind sie zuckersüß und sehr saftig. Beim Kochen geben sie einen goldenen Saft und sind sehr schnell weich. Am besten sind sie, wenn man sie ganz, also unzerschnitten kocht, mit einem Stück Thunfisch. Dies ist ein bretonisches Gericht, das sich "von" schreibt.
Im Allgemeinen ist es sehr ruhig auf dem Markt, nur einen, der einen schönen Eckplatz hat, hört man laut seine Ware anpreisen: "Esset Kirschen, die schönen Bigarreaux! Drei Franken ein Kilo! Vergesst eure Erdbeeren nicht, zwei Franken ein Körbchen! Habt ihr meine Tomaten gesehen? Zwei Franken fünfzig ein Kilo und vier Franken zwei Kilo! Macht gefüllte Tomaten, das gibt Abwechslung auf euren Tisch! Esset Tomaten!!"
"Komm!" sage ich zu Lydia, "wir kaufen bei dem "Brüller" er scheint billiger zu sein."
"Was heißt eigentlich, Brüller'? Ich denke da an jemand, der brennt." (Brennen heißt auf französisch "bruler", (das „u“ spricht man wie ein „ü“.) "Wenn jemand brüllt, das ist jemand, der schreit, nicht jemand, der brennt." -
Wir lachen, dann wandern Kirschen, Erdbeeren und Tomaten in unseren Einkaufswagen. Dem „Brüller“ perlt der Schweiß auf der Stirn, und seine Gesichtsfarbe bekommt Ähnlichkeit mit seinen Tomaten.
Seite 11
Auf dem Rückweg kommen wir noch an Artischocken vorbei, den wohlbekannten riesigen Artischocken der Bretagne. Ich glaube, es gibt keine schöneren auf der ganzen Welt. Jene, die im Winter von Nordafrika kommen, sehen elend aus im Vergleich und es gibt nicht viel zu essen an ihnen, so wenig wie die, die spanischer Herkunft sind. Wir kaufen acht Stück, um vierzig Centimes das Stück und es wird Zeit, dass wir heimgehen, denn unser Einkaufswagen ist übervoll.
27. ]uni
Auf der anderen Seite des Hafens, gerade gegenüber von uns, kam ein Langusten-Schiff heim. jetzt sind sie dabei, ein Riesen Zelttuch von unten her um das Schiff zu spannen.
Seite 12
Auf diese Weise kann das Wasser nicht mehr ins Schiff dringen; denn die Langusten sollen ja lebendig heimgebracht werden, und deshalb sind Spezial Löcher in dem Schiffsrumpf angebracht, wodurch sie dann im Wasser sind. Dieses Wasser wird jetzt abgepumpt, nachdem die Löcher von außen verstopft sind durch das Zelttuch. Die Langusten werden nun in Körben heraus verladen.
Ich sage zu Veronique: "Komm, wir gehen da hinüber und sehen uns das von der Nähe an." Schnellen Schrittes gehen wir um den Kai herum. Von weitem hören wir eine Trauerglocke. Auf halbem Weg müssen wir stehenbleiben, um einen Trauerzug vorbeilassen.
Zuerst kommen zwei Männer. Der rechts gehende trägt ein Kreuz aus Eisen, voller Verzierungen, welches sehr schwer sein muss, denn seine Schulter ist samt seiner Jacke nach unten gezogen, und seinem Gang nach zu schließen, konnte man annehmen, er trage einen Zentner.
Darnach kommt der Pfarrer, ein breiter und großer Mann. Über seinem schwarzen Kleid trägt er ein weißes Gewand, das ihm bis unter die Taille reicht. Ihm folgt das Totenauto nach, und dahinter gehen zuerst die Männer, dann kommen endlich die Frauen. Jede hat ein Körbchen mit Blumen in den Armen. Meistens rote Rosen. Ich finde es sehr rührend, und schöner wie bei uns, dem Toten auf seiner letzten Reise die Blumen nachzutragen, als sie nur so an den Wagen zu hängen.
Im Hintergrund schlägt immer noch die Trauerglocke. Den Schluss des Zuges bildet eine gemischte Masse aus Männern und Frauen, und der Weg ist für uns frei.
Als wir endlich bei unserem "Langoustier" ankommen, ist schon alles vorbei. Die Säemänner sind gerade dabei, das Riesen-Zelttuch oben auf dem Kai wieder zusammenzulegen. Nicht eine Languste kommt uns zu Gesicht. Einige Neugierige stehen dabei und solche, die sich langweilen.
Das Schiff war vier Monate neben Mauretanien, um Langusten zu fischen. Zwei aus der Mannschaft fallen mir besonders auf. Sie sehen sich ähnlich. Sie sind ohne Hemd, haben dunkle Haupthaare und einen dunklen Bart, schöne Menschen.
Seite 13
Einer von den zweien springt zuerst auf einen Autoreifen, der innen im Kai angebracht ist, dann auf die Reling, dann aufs Deck. Er verschwindet. Bald kommt er zurück in einem Boot, gesteuert mit einem Ruder, das er in beiden Händen hält. Ich fühle mich wie zurückversetzt in alte Zeiten. Diese Säemänner gleichen den Gestalten Alexander Dumas, beschrieben vor hundertzwanzig Jahren in seinem Roman "Der Graf von Monte Christo".
Sylvia wäscht den Schiffsrumpf. Das macht man bei Ebbe, indem man mit einem Eimer Meerwasser hinaufwirft und dann mit einem Schrubber bürstet, damit alles Grüne, Seegras und Muscheln entfernt werden. Es ist eine schwere Arbeit, wobei einem, wenn man ganz unten ist, das Wasser auf den Kopf fällt.
Ein alter Fischer kommt her und hi1ft ihr dabei. AIs er dann genug hat, sagt er beim Weggehen: "Das Schwerste ist nun gemacht". Immer gibt es Bande und ein gütiges Herz ist bereit, uns etwas Liebes zu tun.
Der Fischer, der neben uns ein kleines Boot angebunden hat, sagt dann zu Sylvia: Das ist selten, dass ein Mädchen einen Schiffsrumpf säubert, wenn ich einen Sohn hatte, würde ich ohne Zögern zu deinem Vater gehen und um deine Hand anhalten.
Seite 14
7. Juli
Heute, Sonntag, bekamen die Kinder eine große Schüssel voll Stachelbeeren geschenkt. Leuchtende Farben von hellgrün über gelb und hellgrau bis gold. In der Mitte steckte ein grünes Sträußchen Petersilie. Und alles duftete wundervoll frisch nach Garten und Sonne.
8. Juli
In der vergangenen Nacht erwachte ich, weil ich nicht genug Luft hatte zum schlafen. In einem Schiff ist es nicht wie in einem Haus. Die Luft kommt nur von oben, wenn die Schlafstätten unten sind, wie bei uns. Und ich atme so gerne frische, etwas kalte Luft beim schlafen. Man muss sich zuerst daran gewöhnen, dass man nicht nach Herzenslust ein Fenster öffnen kann. Dafür sind wir fast den ganzen Tag im Freien auf dem Deck, wenn's nicht regnet.
Seite 15
Ich stieg die Leiter hinauf aufs Deck und sah nichts als dichten Nebel. Die Straßenlampen gegenüber hatten einen Heiligenschein. Kein Wunder, ging mir die Luft aus. Ich entschloss mich, geduldig zu warten, bis die Morgensonne den Nebel vertreibt.
Kaum war ich wieder unten, so hörte ich den Motor eines Fischer schiffes, das immer näher kam, laute Männerstimmen und jemand, der sich auf unser Deck fallen lieg, dann ein Zweiter. Sie vertauten sich an unser Schiff. Sie sprangen aufgeregt hin und her und schrieen zu ihrem Schiff hinüber, die drüben schrieen herüber. Wenn man vom Meer kommt und dann sein Schiff irgendwo festmacht, sei es am Kai oder an einem Schiff, muss man immer sehr aufpassen, damit es nicht schief geht. Man kann leicht sein eigenes oder ein anderes Schiff beschädigen. Als sie den Motor abgestellt hatten, ging ihr vorhergehendes Schreien in ein ununterbrochenes Schwatzen über, alles im bretonischen Dialekt. Mit dem schlafen war es also ganz aus.
Bald wurde es Tag, und sie erzählten uns dann, sie seien um drei Uhr morgens vom Fischen zurückgekehrt und hatten vor lauter Nebel nichts gesehen, nur ein weißes Schiff, das glänzte (das unsere), und dann hätten sie sich halt daran vertäut.
Sie waren vier Tage im Meer beim Krebs fischen. Jetzt bei Ebbe, nachdem sich ihr Schiff vom Meerwasser geleert hat, beginnt ein reges Leben bei ihnen. Wir können nun von ganz nahe zuschauen. Vom Schiffsraum wird mit Seilen eine Kiste hochgezogen, dann wird sie aufs Deck geleert. Nun wimmelt es von Krebsen und Meerspinnen. Ein Fischer packt sie, die Krebse an ihren Gehäusen und die Meerspinnen an ihren Füssen, und schichtet sie sehr schön in eine Kiste, immer die Füße nach unten, Krebs neben Krebs, und Meerspinne neben Meerspinne in eine andere Kiste. Wie braune Steine liegen nun die Krebse neben- und übereinander. Wenn einer wagt, sich zu bewegen, wird er sofort wieder an seinen Platz zurückgeschlagen. Die Meerspinnen haben eine sehr schöne rote bis rot blaue Farbe. So füllt sich Kiste um Kiste. Dem Mann bluten die Hände. Er kümmert sich nicht darum. Dann werden andere Tiere von unten aufs Deck geleert. Die haben lange Antennen, einen langen Körper und schlagen mit dem Schwanz um sich. Eine prächtige rosarote Farbe haben sie. Es sind die sehr gesuchten Langusten. Es sind große dabei. Auch sie werden zusammen in Kisten geschichtet. Zuletzt kommen noch schwarzblaue Tiere heraus mit zwei sehr großen Zangen und einem ganz schmalen Körper. Es sind Hummer. Sie nehmen denselben Weg wie alle anderen, und alle Kisten zusammen werden in ein Lastauto verladen.
Seite 16
Ich konnte mir zwei Krebse erwerben und bekomme noch dazu eine Meerspinne geschenkt vom Chef. "Ja", sagt er, "wir waren vier Tage im Weiten der Insel Sein. Unsere Fallen lassen wir eine Nacht mit dem angebundenen Fleisch darin auf den Meeresgrund hinunter, dann sind sie schon voll von den Tieren, denn der Krebs ist gierig auf Nahrung". Sagt man nicht in Deutschland "ich habe Hunger wie ein Krabb!". "Crabe" ist tatsächlich das französische Wort für Krebs. Früher wusste ich nicht, was das bedeutet. Mit der Zeit versteht man manches im Leben. Sie sagten: "Im Dezember und im Januar fischen wir am meisten. Da gibt es so viele, dass wir sie nicht heimbringen können. "
Noch ein letzter Behälter wird aufs Deck geleert. Jeder von den Fischern, es sind sieben, nimmt, was er gerne hat, in einen Sack, einmal mehr Krebse, einmal mehr Meerspinnen. Es ist für die Mutter oder für die Frau. Jeder wirft seinen Sack auf den Rücken und einer nach dem andern nimmt den Weg über unser Deck nach Hause.
Es ist jetzt wieder ganz stille geworden.
11 Juli
Heute ist der Tag, wo die Flut am höchsten ist, also der Tag, an dem wir fortgehen. Alles ist bereit. Wir ziehen die schweren eichenen Krücken herauf und "Perle des vagues" kann nun frei hinausfahren. Ray lässt langsam den Motor laufen. Flore und Sylvia binden die letzten Taue los.
Seite 17
Wir fahren langsam noch um eine gefährliche Sandbank herum, und mit einer schönen Kurve kommen wir auf der anderen Seite des Hafens an. Da ist die Hauptstraße von Audierne. Ein großer Haufe Neugieriger empfängt uns. Ihre "Perle" war auch schon lange nicht mehr so sauber und so schön zum Angucken. Wir machen uns hier wieder am Kai fest und füllen unsere zwei Behälter mit Trinkwasser. Rohöl und alles, was wir zum Essen brauchen, ist bereits an Bord, und wir konnten gleich unsere Seereise beginnen, aber der frühere Besitzer von "Perle des Vagues" hat einem Mann telefoniert, der hier auf der Hauptstraße einen Laden hat: wir sollen warten. Morgen früh um fünf Uhr würde er mit seinem kleinen Fischerboot vor uns herfahren, um uns den Weg zu zeigen, den wir nehmen müssen. Es ist viel besser so, denn er kennt den Hafen gut. Wir könnten leicht auf eine Sandbank laufen, von denen es hier am Ausgang des Hafens mehrere gibt und uns aufs Trockene setzen.
Noch eine Nacht Schlaf. Morgen früh die große Reise ins Weite.
Auf dem Meer
12. Juli
Wie ausgemacht, schon vor fünf Uhr früh ist der Mann da. In Eile ziehen wir uns an. Der Motor läuft an. Zum letzten Mal werden die Taue vom Hafen gelöst. Adieu Audierne! Du schläfst jetzt noch. Bei deinem Erwachen wird "Perle des Vagues" nicht mehr da sein, der Kämpe deiner „thoniers“ der zwanzig Jahre zum Stolze deines Hafens gehörte, den du immer bewundert hast, wenn es draußen noch so stürmte, wenn er bis nach Irland fuhr und wenn er trotz Sturm und heulendem Unwetter immer gesund und munter in deinen Hafen zurückkehrte. Ja, er hat dir etwas vorgemacht. Jetzt ist sein Schicksal ein anderes geworden. Er fährt in den Süden und er kommt nicht mehr zurück. Vielleicht wird er einmal der Stolz eines anderen Hafens sein?
Die letzten Häuser verschwinden. Der Mann, der vor uns herfährt, macht kehrt und kommt auf uns zu, und Bord an Bord verabschieden wir uns mit herzlichem Dank und einem letzten Händedruck. Er nimmt nun den Kurs dahin, wo es Fische gibt, und wir fahren allein hinaus in die wogende Flut.
Seite 18
Ray reguliert den Kompass, ich halte das Steuerrad. Das Meer beginnt sich sehr zu bewegen und geht hohl. Ich merke, dass mir trotz dem besten Willen der Kopf schmerzt bis zum Schwindel und dass mir schon die Magensäure heraufkommt. Gegessen haben wir noch nichts. Eins nach dem andern werden wir seekrank, bis auf Ray. Essen ist ganz nutzlos, es wird nichts drinbleiben.
So vergeht der zwölfte Juli und die Nacht des zwölften Juli. Meer sehr bewegt, starker Wind.
13. Juli
Meer sehr bewegt, starker Wind. Dünung, Regen. Wir können nicht einmal mehr aufs Deck. Wir liegen unten, vom Motor Lärm und Gestank nur durch eine Tür getrennt. Hier liegen wir wie vergiftet, wie halb bewusstlos, nur eine Bewegung und wir brechen Galle. Im Vorderposten können wir nicht mehr schlafen, denn dort wird man am meisten verschüttelt. Das Meer tobt. Die entfesselten Wellen schlagen an die Fensterscheiben der Kommandobrücke. "Perle des Vagues", jetzt gilt es, deinen Mann zu stehen!
Seite 14. Juli
Man kann sich nur noch mit großer Mühe anziehen. Zwischendurch brechen wir dicke Galle. Wäre es nicht besser, zu sterben? "Es gibt die Lebendigen, die Toten und diejenigen, die ins Meer gehen." Die sind also weder tot noch lebendig? Wahrlich, das erleben wir jetzt! So kann der Herr manchmal in die Holle führen, aber zum Trost wissen wir, dass er auch wieder herausführt. "Herr erbarme Dich unser! Mach', dass das Meer stille wird. Mach', dass der Wind sich legt. Du bist der Herr Himmels und der Erde und des Meeres."
Flore, der es etwas besser geht, bringt mir heute Abend einen Hagebuttentee. Drei Tage haben wir nichts gegessen und nichts getrunken. Draußen fährt ein großes Schiff vorbei, alle Lampen hell beleuchtet - ein Märchenschloss auf dem Meer, es ist ja der vierzehnte Juli, das französische Nationalfest.
Seite 15. Juli
Heute früh beugt sich Ray über mich: "Ich rate dir, aufs Deck zu gehen und in den Liegestuhl zu liegen. Es ist schönes Wetter. Das Meer hat sich beruhigt. Das Barometer steigt." Jetzt liege ich im Liegestuhl und kann wieder etwas trinken und essen. Die Seekrankheit ist vorbei. Der Himmel und das Meer sind blau, und das Leben ist schön. "Gelobt sei der Herr!"
Ein sehr schönes und großes norwegisches Frachtschiff fährt vorbei, "Ranhav Christensand" ist sein Name. Vielen anderen sind wir heute begegnet von verschiedenen Formen und Nationalitäten. Gerade kreuzt uns ein spanischer Dampfer. Er heißt "Charlie". Ein schwarzer Rauchqualm kommt aus seinem Kamin. Agnès sagt: "Guck, wie die Spanier Schiff fahren!"
Um zwei Uhr herum holt Ray sein Marineglas und schaut nach links an den Horizont, dann ruft er "Festland! Das ist Spanien. Wir sind jetzt am Ende des Golfes von Gascogne angelangt und werden wohl heute ab end um neun Uhr den Leuchtturm des Kaps Finisterre sehen. Dann müssen wir den Kurs ändern."
In den drei Tagen schlechten Meeres hat uns "Perle des Vagues" gezeigt, dass sein guter Ruf auf Wahrheit besteht. Nicht im geringsten ist er übertrieben. Man spürt es am Steuerrad. Dieses Schiff widersteht dem bösen Meer mit Geschmeidigkeit.
Es ist nun Abend. Den ganzen Nachmittag fuhren wir an der immer deutlicher werdenden spanischen Küste vorbei. Es ist etwas besonders schönes, wenn man auf dem Meer ist und an Land vorbeikommt. Unzählige große Schiffe zirkulieren hier, meistens Petroleumschiffe. Es wimmeIt geradezu davon. Viele lassen einen schwarzen Rauch von sich. Da muss man sich wundern. Anscheinend heizen manche noch mit Kohlen.
Wir warten bloß darauf, bis es Nacht wird und die Spanier ihre Leuchttürme anzünden. Endlich tauchen auf einem Berg weiße Lichter auf, zwei Lichtblitze hintereinander alle fünfzehn Sekunden. Das ist das Kap Villano. Vierzig Meilen weit kann man es bei klarem Wetter draußen erkennen. Etwas weiter sehen wir plötzlich auf einem hohen Berg ein scharfes weißes Licht, das alle fünf Sekunden aufblitzt. Das ist das Kap Finisterre, lat. finis terrae = Ende der Erde, die äußerste Ecke von Spanien. Ray ruft Sylvia, die am Steuerrad sitzt, zu: "Kompass 210!" Dies ist der Kurs nach den Kanarischen Inseln.
Seite 16. Juli
Das Meer hat nun wieder eine tiefblaue Farbe. Es ist weder kalt noch warm. Seit gestern Abend haben wir 60 Meilen zurückgelegt. Wir sind jetzt in der Weite von Portugal. Vereinzelte große Schiffe kreuzen uns.
Seite 20
17. Juli
Wir sind noch immer auf der Höhe von Portugal. Das Meer ist dunkelblau, der Himmel hellblau mit weißen Wolken, viel Wind. Ein dickes Schiff in der Ferne. Wir sind auf der Höhe von Lissabon.
Wenn man auf dem Deck sitzt und schaut zum Horizont, und wollte das Meer mit der Erde vergleichen, so wären es lauter kleine und größere Berge, die sich ununterbrochen verschieben, unaufhörlich auf- und untertauchen. Ihre Farbe ist tiefblau mit etwas flaschengrün an den Rändern. Aus den obersten Spitzen sprudelt ein weiß perlender Schaum. Wenn die Sonne darauf scheint, dann bekommen diese nassen größeren und kleineren Berge einen silbernen Überzug, viele Meilen weit bis zum Horizont.
Drei Seemöwen umkreisen immer denselben Ort. Tauchen unter, umkreisen. Tauchen unter, umkreisen.
Bei Tag habe ich keine Angst, aber wenn es Nacht wird und ich steige hinab in meine Kajüte, kommt manchmal die Angst vor dem Meer. Wir schlafen im Vorderposten. Von draußen hört man das Meer. Die schnaubende Dünung schlägt an den Schiffsrumpf und mein Nachtlager gleicht einer Schaukel. 0 diese Dünung! Seit der Bretagne hat sie uns begleitet. Man hört sie schon von weitem rollen, dann muss man sich festhalten. Logischer Weise gibt es keine Gefahr. Haben Frauen Logik? Schreckliche Geschichten und Legenden, die man übers Meer gehört oder gelesen hat, tauchen auf. "Herr, es ist nicht möglich, dass wir untergehen, dass die Kinder untergehen. Du lebst, deshalb leben wir auch. Nimm mir meine Angst weg, Herr! - Was hat der Mann gesagt, am Tag vor unserer Abreise? "Euer Schiff habe ich gesehen, als es gebaut wurde, ungefähr zur gleichen Zeit wie das meine. Der Bauplatz hieß "Bolschewik". - Nicht viel Holz, nicht schwer gebaut, mit wenig Holz gebaut. Ein Vogel auf dem Meer!
Was der Mann sagen wollte, habe ich damals nicht richtig verstanden, denn Schiffsbauweise ist für mich etwas Unbekanntes. Aber jetzt spüre ich, was er meinte: Dieses feine und elegant gebaute Schiff bleibt nicht schwerfällig in der Wogentiefe stecken, um nachher brutal wieder herauszukippen, sondern es geht mit Nachgiebigkeit darüber hinweg, wie ein Vogel auf dem Meer. Deshalb hat der Herr uns dieses Schiff finden lassen, weil ER immer das Beste für uns hat.
Meine vorherige Angst hat sich in ein sanftes Wiegen verwandelt.
Seite 21
18. Juli
Seit gestern legten wir 160 Meilen zurück. Portugal haben wir überholt, sind nun auf der Höhe von Gibraltar. Ganz nahe kreuzen wir ein blitzblankes Frachtschiff. Es ist weiß und hat einen roten Kamin. "Conoco Sopi" ist sein Name.
Die See hat sich nun endlich beruhigt, und es ist das schönste Wetter, das es geben kann. Heute ist Donnerstag. In vier Tagen, also am Montag, kommen wir an den kanarischen Inseln an. So Gott will und wir leben.
Sonntag, 21. Juli
Wir sind jetzt noch hundert Meilen entfernt von den kanarischen Inseln, das bedeutet noch ungefähr zwanzig Stunden.
In der vergangenen Nacht zwischen eins und drei Uhr war dichter Nebel auf dem Meer. Man sah keine zehn Meter weit. Von Zeit zu Zeit hupten wir die Nebeltrompete. Heute nun ist das schönste Wetter, ein ganz herrlicher Sonntag. Nach den vier Himmelsrichtungen bis zum Horizont stilles Meer in seinen schönsten Farben, überspannt von dem klaren Licht eines wolkenlosen Himmels. Wahrlich ein Tag des Herrn! "Wie vollkommen hast DU alles gemacht!" Hier ist kein Menschenlärm und keine überfüllte Großstadt, und außer uns gibt es niemand hier, höchstens ein anderes Schiff und die vielen Fische unter uns, aber "neben und über uns
"bist nur Du oh Herr"
Die zwei Mädchen auf der Kommandobrücke singen ein Lied. Eine sitzt am Steuerrad und die andere "hat das Auge". - Liebe Melodien kommen uns in den Sinn. Konnte es auch anders sein? Wir fahren doch in Kanarienvogels Land.
Wie kann man diese Stimmung beschreiben? Ferien. Kreuzfahrt in den Weiten der kanarischen Inseln. Schönes Wetter. Stilles Meer. Morgen früh Las Palmas.
Seite 22
Die Kanarischen Inseln
Las Palmas
22. Juli
In der vergangenen Nacht erhob sich plötzlich ein starker Wind.
Unser Schifflein wurde nicht wenig geschüttelt. Ray folgte dem Leuchtturm. AIs der Tag sich erhob, sahen wir Land - Häuser. Der erste Eindruck: Enttäuschung. Öde Mietskasernen stehen wie kleine und größere Kisten dem Meer entlang - als Hintergrund ein kahler Berg. So fahren wir ungefähr noch eine Stunde der Küste entlang. überall dasselbe trostlose Bild.
Beim Einfahren in den Hafen sind wir unangenehm berührt von der trüben Farbe des Meeres und der stinkenden Luft, die uns entgegenkommt. Wir fahren bis zu einer stillen Ecke, wo kein Kai ist und werfen den Anker aus, nicht weit weg von einer weißen Jacht. An ihrem hinteren Mast flattert die Schweizer Fahne.
Wie von weitem so in der Nähe. Nur hässliche unförmige Kisten, wo das Auge hinblickt, umgeben von nackten Bergen. Nicht ein grüner Fleck, nicht ein Baum. Doch, vor einem einzigen Haus ein paar niedere Palmen, und bei längerem Hinsehen entdecke ich noch einen einzelnen Baum in einer hinteren Straße.
Diese Stadt, am Hafen entlang gebaut, heißt La Luz. Etwas weiter heißt sie Las Palmas. Beide sind zusammengebaut und sind neun Kilometer lang und nur zweihundert Meter breit. Wenn man die zweihundert Meter durchläuft, kommt man an den Strand, wo viele Badende sind. Hotels - Sonnenschirme - runde Tische - Stühle - lachende Deutsche.
Im Winter, sagte uns ein Mann, seien diese kahlen Berge zum Teil mit grünen Tomatenpflanzungen bedeckt. Das sei die schöne Jahreszeit. Im Hafen sei eine Jacht neben der anderen und der Strand bedeckt mit Schweden und Norwegern. Sie würden einer neben dem andern liegen, nicht einmal mit einem Taschentuch geschützt, und würden furchtbare Sonnenbrände bekommen.
Seite 23
Im Winter ist auch die günstige Jahreszeit, um nach Westindien (die Antillen) zu fahren. Jetzt im Sommer gibt es Taifune dort. Diese Schiffe halten auch alle an den kanarischen Inseln.
Der Bus bringt uns für wenig Geld nach Las Palmas. Ob kurze oder lange Strecke, es ist derselbe Preis. Hier gibt es viele schöne Läden, einen Riesen-Supermarkt, und jeden Vormittag einen überdeckten Gemüse- und Obstmarkt. Den Bewohnern des Landes gelingt es, im Innern der Insel Tausende von Tomaten und Bananen aus dieser trockenen Vulkanerde herauszubringen. Man fragt sich, wie. Anscheinend bedecken sie den Boden mit kleinen Lava Steinen, um die Erde vor dem Austrocknen zu bewahren.
Alles ist sehr billig hier. Lebensmittel oder Kleider und sonstige Gegenstände sind zur Hälfte oder zwei Drittel billiger als in Frankreich.
In der Hauptstraße gibt es zwischen anderen schönen Läden viele große Schuhläden mit so viel Auswahl, wie ich es sonst nirgends sah. Wunderschöne Sommerschuhe und Sandalen in allen Farben und Formen. Wir gehen in den Laden, um uns Sandalen zu kaufen. Plötzlich kommt ein Mann herein. Auf die Schuhe von Flore deutend, sagt er, er wolle dieselben haben. Natürlich kann er nicht wissen, dass sie in Brüssel gekauft wurden. Wir können auch nicht genug spanisch, um uns zu erklären. So steht er da und wartet. AIs er merkt, dass sich niemand um ihn kümmert, geht er gerade so schnell wieder hinaus, wie er hereingekommen ist, seine ondulierten Haare hin-und her wippend, denn er muss noch ein paar Mal den Kopf zurückdrehen, um nach den begehrten Schuhen zu sehen. Dies ist eine lustige Schuhgeschichte aus einem Geschäft in Las Palmas.
Nun gehen wir die Straße zurück, sehen uns noch viele schöne Schaufenster an, dann kommen wir an einen großen wohlgestalteten Platz mit Palmen, Kakteen und sonstigen Bäumen. Von hier aus fahren wir mit dem Bus zum Hafen zurück.
Wir kommen an manchen angenehmen Seitenstraßen vorbei, an schönen Häusern, an Palmen und Blumen. Ein riesiger Kaktus geht bis zum ersten Stock eines Hauses. - Zwei Mädchen steigen ein, als der Bus hält.
Seite 24
Sie kommen vom Strand und ihre sehr langen Haare sind ganz nass. Sie setzen sich in die hinterste Ecke, wo sie bei ununterbrochenem Schwätzen ohne aufzuhören ihre nassen Haare kämmen. Junge Männer sitzen ihnen gegenüber, und sehen ihnen zu.
Der Hafen hier ist sehr verkehrsreich. Noch nie sah ich solch einen lebendigen Hafen. Ununterbrochen fahren Schiffe aus und ein. Vom kleinen Fischerschiff bis zum größten Dampfer. Langweilig kann es einem hier unmöglich werden. Ein Junge, der von Schiffen träumt, könnte hier nach Herzenslust den ganzen Tag die ein- und ausfahrenden Schiffe begucken, und abends, wenn der Hafen und die vielerlei Schiffe ihre Lichter scheinen lassen, und der Leuchtturm brennt droben auf dem Berg, und das Meer alle diese funkelnden Lichter und Lichtlein widerspiegelt, dann käme er sicher in eine ganz festliche Stimmung.
Heute ist ein russischer Riesendampfer hier. Sein mächtiger Kamin ist mit Glasrohren versehen, in denen ein starkes Licht brennt und die die Form von Sichel und Hammer haben. Diese leuchten weit in die Welt hinaus und können von niemand übersehen werden.
Die Fischerschiffe sehen sich alle gleich, sind aus Eisen und haben einen lustigen Charakter, sind nicht so ernst wie die in Audierne, aber dafür nicht so sauber. Kaum waren wir angekommen, so fuhr eines hinaus, la "Santa Luzia". Ein dicker Mann saß auf der Kommandobrücke am Steuerrad. Die beiden Türen links und rechts standen weit offen. AIs er an uns vorbeifuhr, sahen wir ihn gerade im Profil. Sein Bauch machte eine runde Kurve, und er war festgeklemmt für die Seereise zwischen Steuerrad und Sitz. Auf der anderen Seite des Steuerrades war gerade noch Platz für einen Teller. Ein wahrlich lustiger Hafen, der von La Luz. - Die Spanier auf dem Deck und wir winkten uns gegenseitig.
Monsieur R., ein Franzose, wohnt zwölf Kilometer weg von Las Palmas. Er kam mit seinem eigenen Schiff hierher. Dieses kaufte ihm dann ein Amerikaner ab, nachdem er und seine Frau dreizehn Monate lang im Hafen gelebt hatten. Oft kam Monsieur R. zu uns an Bord. Er warnte uns vor den kapverdischen Inseln. Dort sei immer viel Wind und viel Nebel, und manches Schifflein sei an deren Felsen zerschellt. Und "vor allem", betonte er, "kommt nicht bei Nacht an, denn die Portugiesen zünden ihre Leuchttürme nicht an." Ray dachte nun, dies ist ein gefährliches Schiff fahren und es ist vielleicht besser, wir gehen nach Dakar, obwohl wir zweieinhalb Tage länger brauchen. Aber es ist sicherer.
Nun kam der 2. August, mein Geburtstag, und ich erwartete irgendwie etwas Besonderes vom Herrn. Nachmittags kam ein Bekannter an Bord namens Michel
Seite 26
Er hat auch schon manches Segelschiff durch verschiedene Ozeane geführt. Unter anderem war er in Guayana, den kapverdischen Inseln und Dakar.
Als ich ihm erzählte, dass wir wohl nach Dakar gehen, sagte er:
"Für mich ist das ein Irrtum. Mit eurem Schiff riskiert ihr absolut nichts, und wenn ihr nach Dakar geht, ist das ein Umweg von 450 Meilen, der viel Geld kostet. Und für alles, was ihr dort kauft, werdet ihr drei- oder viermal so viel bezahlen wie hier, denn Dakar ist die teuerste Stadt der Welt. Außerdem ist das Meer sauber im Hafen von Porto Grande (Cap Vert) und ihr seid ruhig dort."
Mir leuchtete dies wohl ein und ich dachte, dieser Rat ist das Geschenk des Herrn. Ray wollte aber nichts wissen. Dakar ist für ihn besser.
4. August
Morgen wollen wir weiterreisen. Die Frage steht jetzt offen: Dakar oder die kapverdischen Inseln? Ich möchte Ray nicht beeinflussen. Die Führung des Schiffes überlasse ich ihm. Auf seine Frage kann ich nur sagen, dass ich keine Freude habe, nach Dakar zu fahren.
5. August
Heute reisen wir von den kanarischen Inseln ab. Ray geht ein letztes Mal in die Stadt, um noch etwas Wichtiges zu kaufen. Ich sagte ihm: "Vielleicht kommt dir unterwegs die feste Gewissheit, wo wir hin sollen." Gegen 11 Uhr kommt er zurück. "Ja, wir gehen nach Dakar." Wir sprechen ein letztes Gebet. Ray sagt: "Herr, wir haben uns entschlossen, nach Dakar zu fahren. Wir denken, dass es so Dein Wille ist und überlassen uns Deiner Führung. Was auch vorkommt, wir sind in Deiner Hand." Daraufhin ziehen wir den Anker herauf. Auf einmal ist mit aller Kraft die Kette nicht mehr zu bewegen. Der Anker muss irgendwie eingeklemmt sein. Vielleicht in ein Kabel. Ray lässt den Motor laufen, und wir fahren etwas vor. Dies war das Richtige, denn die Kette lässt sich jetzt nach oben ziehen, und der Anker kommt langsam und mit vieler Mühe herauf. AIs er oberhalb des Wassers auftaucht, sehen wir zu unserem großen Erstaunen, dass wir einen zweiten Anker mit heraufgezogen haben. Kein Wunder, brauchten wir Riesenkräfte.
Es ist jetzt kurz nach zwölf Uhr, als wir die kanarischen Inseln verlassen - blauer Himmel, blaues Meer. Am Ausgang des Hafens liegt der Schlepper.
Seite 27
Auf dem Deck steht ein Mann, auf der Kommandobrücke steht ein anderer. Sie haben beide ein Taschentuch in der Hand und winken unaufhörlich zu uns herüber. AIs ich ein Weilchen mit der Hand gewinkt hatte, winke ich auch mit dem Taschentuch und denke: es ist vielleicht so Sitte in diesem Land, dass man mit dem Taschentuch winkt beim Abschied - ein Zeichen, dass man sich eine heimliche Träne abgewischt hat. Adieu Las Palmas! Langsam geht's hinaus ins Weite.
Nun fahren wir doch nach Dakar. Sollte ich mich getäuscht haben?
Ich werde traurig bei diesem Gedanken. Nun, die Fahrtrichtung kann man ja immer noch ändern. Ich vertraue dem Herrn. Während ich so vor mich hinsinne, tritt Ray zu mir her und sagt: "Wir fahren nach den kapverdischen Inseln". - "Ja? Warum?" - "Wegen dem zweiten Anker, den wir heraufgezogen haben. Dies ist mir das Zeichen.
Wie froh wurde ich in meinem Herzen, auch darüber, dass ich auf keine Postkarte, die ich von Canaria aus schickte, darauf schrieb: "Wir fahren nach Dakar."
Noch lange sahen wir die Erde. Möven begleiteten uns. AIs die Sonne unterging, färbte sich der Himmel zu unserer Rechten in ein herrliches Orange, gemischt mit etwas Lila. Davor stand der beinahe viertausend Meter hohe Berg der Insel Teneriffa. Letztes Erden Bild. - Zu unserer Linken stand schon der Mond am Himmel, der mit silbernem Licht zu uns herunter leuchtete.
Seite 28
7. August
Meer bewegt, fliegende Fische links und rechts.
8. August
Wir sitzen nun unter Ray's großem schwarzen Regenschirm, damit wir etwas Schatten haben. In einer Stunde sind wir unter den Tropen, will sagen am Wendekreis des Krebses.
9. August
Gestern und heute Morgen lagen je zwei fliegende Fische tot auf dem Deck. Diese Fische schmecken sehr gut und es ist eine besondere Freude, wenn sie einem buchstäblich zugeflogen kommen. "Lieber Herr", bitte ich heute Abend, "mach doch, dass wir einmal für jeden einen bekommen."
10. August
Heute Morgen liegen sechzehn fliegende Fische auf dem Deck. Das macht zwei für jeden. "Herr, ist' möglich? Bis an die Himmel reicht Deine Güte, bis zu den Wolken Deine Treue!"
Wir kommen jetzt den kapverdischen Inseln immer näher. Ray sagt: "In acht Stunden sollen wir die Erde sehen, ungefähr um zwei Uhr morgen früh." - Um diese Zeit sitzt Sylvia am Steuerrad und Lydia macht die Aufpasserin. Um 01.30 Uhr wache ich auf und wecke Ray, der geschwind eingeschlafen war: "Du sagtest doch, wir sehen Land um zwei Uhr." Er steht gleich auf und geht nach vom. Kaum guckt er ein Weilchen so ruft er: "Jetzt sieht man das Festland!"
Weit am Horizont ist ein dunkler Fleck wie eine Wolke. Normalerweise sollten wir ja das Licht des Leuchtturms sehen. Dieses sehen wir aber erst um 4 Uhr morgens, und zwar so schwach, dass die Kinder sagen, ob dies wohl der Schein einer Kerze wäre.
Nach kurzer Zeit erhebt sich ein starker Wind, und wir stellen den Motor auf "langsam" und warten bis der Morgen graut.
Seite 29