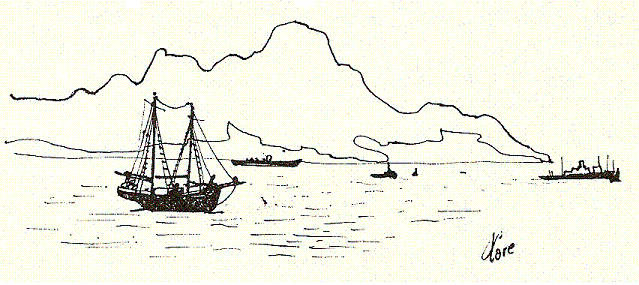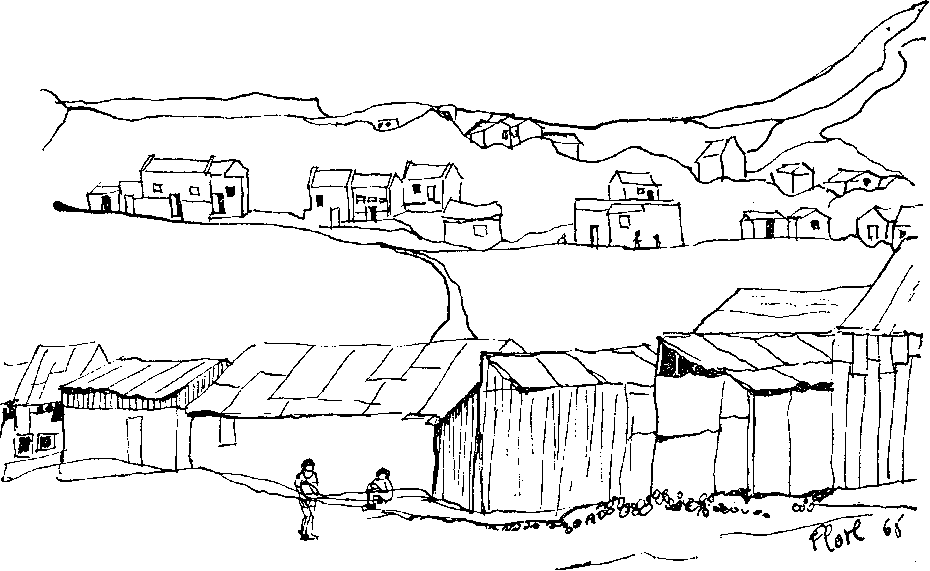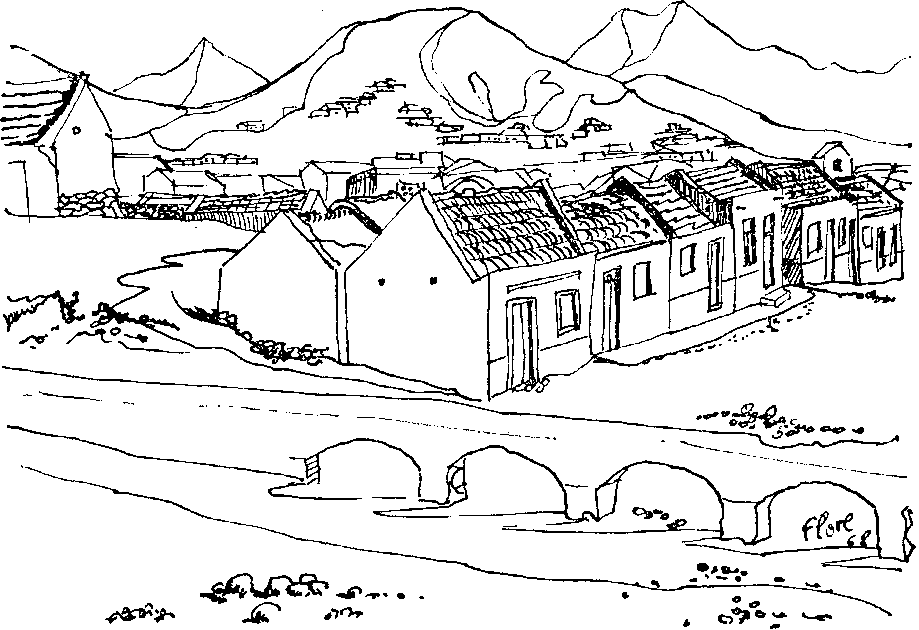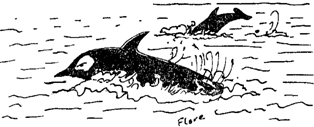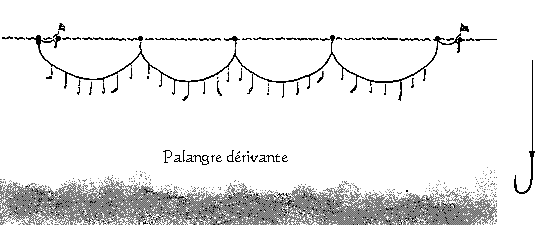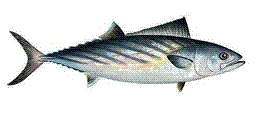Die Kapverdischen Inseln
Hohe kahle Berge erscheinen nun, von weitem die großen Behälter von Shell, weit hinten der Kai. Drei Boote kommen uns entgegen. Schwarze sitzen darin. Sie rudern an uns vorbei. Wir wundern uns, dass sie bei solch einem Wind ins Meer hinausfahren. Später werden wir uns nicht mehr wundern, denn dies ist ein Normalzustand hier.
Nun kommen wir am Hafendamm an. Es gibt Platz genug. Nur zwei sehr schöne Segelschiffe sind noch auf dieser Seite. Schwarz häutige Jungen sind auf dem Deck und schauen zu uns herüber. Schwarze Beine kommen in Bewegung auf dem Kai. AIs wir nahe heranfahren an unseren endgültigen Platz, sind es ungefähr zehn, die uns empfangen. Sie sind gleich eifrig dabei, uns beim vertäuen unseres Schiffes zu helfen. Alle diese jungen Leute haben eine schwarze Haut, mehr oder weniger dunkel. Ihre Kleidung ist verlottert und schmutzig, und alle sind barfuß Nun stehen sie da und schauen auf das französische Schiff wie Kinder auf den Weihnachtsbaum.
Es ist vielleicht jetzt acht Uhr morgens. Der Hafen hier heißt „Porto Grande“, man spricht portugiesisch. Die Polizei und ein Arzt kommen an Bord. Diese sind schneeweiß gekleidet. Der Arzt hat eine schwarze Brille auf der Nase. Sie wollen weiter nichts von uns. Lassen nur ein Papier zum Ausfüllen da, dann gehen sie wieder.
Seite 30
Die Masse der Neugierigen wird immer größer, je mehr der Tag vorrückt. Die einen gehen, viele bleiben stehen, neue kommen. Diejenigen, die schon stundenlang da sind, setzen sich zu guter Letzt auf den Hafendamm und lassen ihre Füße zu uns herunterhängen. Nirgends sah ich solch vernachlässigte und zerlumpte Menschen. Kein Wunder - auf dieser Insel gibt es keinen Tropfen Wasser und es regnet nie. Früchte und Gemüse kommen von der Nachbarinsel. Dort regnet es und gibt es Wasser, sie ist nur zehn Kilometer entfernt. Diese Insel hier mit dem Namen Sao Vicente lebt nur von dem Hafen. Die Jungen haben keine Arbeit, lungern herum und betteln.
Heute Nachmittag kommen viele Lastautos, hochbeladen mit leeren, verbeulten Blechfässern, zusammengebunden mit einer Schnur. Wenn sie hier ankommen, wird die Schnur abgeschnitten und sämtliche Fässer fallen mit donnerndem Krachen auf den Kai. - Abladesystem „à la Cabo Verde“. Diese misshandelten und vielverbeulten Gefäße kommen auf ein Schiff. Alsdann werden sie auf der Insel daneben, welche Santo Antao heißt, mit Wasser gefüllt. Hernach kommen sie wieder zurück, und dies ist das einzige Wasser, von dem die Bevölkerung hier lebt.
Gegen vier Uhr, wenn die Sonne nicht mehr so hoch am Himmel steht, gehen wir in die Stadt. Sie heißt Mindelo. Wir brauchen nur um den Hafen herumzugehen, dann sind wir dort. Zuerst kommen wir an einem kahlen Berg vorbei. Auf dessen Spitze steht ein ödes Haus. Früher eine Festung - heute das Staatsgefängnis. Bald kommen wir an andere, freundlichere Häuser. Sie sind bunt. Blau, rot, gelb und grün. Die Dächer rosa. Manchmal steht ein vereinzelter Baum da, der erbärmlich aussieht. Man fragt sich, wie er leben kann in einem Land, wo es nie regnet.
Seite 31
Wir gehen eine Seitenstraße hinauf und kommen an dem Markt vorbei. Es ist ein großes geschlossenes Haus mit einem schwarzen eisernen Tor, das offen steht, denn heute am Sonntag ist auch Markt. Wir gehen nicht hinein, sondern sehen uns das Haus nur von außen an. Oben steht geschrieben "mercado". Der erste Stock besteht aus einer offenen Terrasse. Viele Säcke sind dort aufgestapelt. Auf der Straße und am Eingang stehen in Lumpen gekleidete Kinder, die gleich auf uns zukommen und die Hand hinstrecken "Senora!" Diese Kinder sind zum Betteln erzogen. Heute können wir ihnen nichts geben, denn wir haben noch kein Geld umgewechselt.
Wir gehen bis zum Ende der Straße, denn schon von weitem sahen wir ein sehr schönes, großes, rosarotes Haus, das auf einem Platz steht. Es ist der Wohnsitz des Gouverneurs, der zurzeit in Ferien ist. Vor dem Haus ist ein runder Garten, der leider nicht schön angepflanzt ist. Anstatt sie ein und dieselbe Pflanze in die Rundung gesetzt hätten, zum Beispiel nur Sansevierien, die hier blau, sehr schön gezeichnet und hochgewachsen sind, und dadurch dem Garten eine edle Ausdrucksweise verliehen hätten, sind nur einige Sansevierien und dazwischen ein paar Büschel ganz grobes Gras. Grober als das auf unseren Wiesen. Sicher verträgt es gut die Trockenheit hier. Außerdem befinden sich noch ein paar schmale zementierte Wege in dem Garten. Ab und zu steht ein abgeschnittenes, grün angestrichenes Holzfass da, in dem eine Pflanze sprießt. Auch dem Rand der großen Plattform entlang, die der ganzen Breite nach das Vorderteil und zugleich den Eingang des Hauses bildet, stehen abgeschnittene Fässer, grün angestrichen, diesmal aus Blech. Aus jedem guckt eine grüne Pflanze heraus. Das Ganze gibt höchstens einen grünen Ton in die kahle Gegend, doch schön kann man es nicht nennen.
Hinter dem Haus stehen eine Palme und noch ein anderer Baum. Diese sehen satter aus und ihre Blätter sind dichter und grüner als die seltenen übrigen Bäume der Insel, sicher weil sie ab und zu begossen werden.
Seite 32
Wir gehen weiter durch holprige Straßen. Es ist etwas Besonderes um dieses Land. Es hat einen ganz persönlichen Stil, den es nur hier gibt. Die meisten Leute, denen wir begegnen, laufen barfuß. Sie starren uns an wie etwas nie Gesehenes. Wir laufen geradezu Parade durch die Straßen. Verwahrloste Kinder gehen neben uns. Ganz von der Nähe müssen sie uns betrachten. Alle unsere Bemühungen, sie fortzuschicken, sind umsonst. Wenn wir stehen bleiben, bleiben sie auch stehen. Wenn wir weitergehen, folgen sie uns auf dem Fuße. Dabei unterhalten sie sich laut schreiend in einer Art portugiesisch, dass uns die Ohren gellen. Solch einen Spaziergang haben wir wirklich noch nie gemacht, und solch eine Begleitung auch noch nie gehabt.
Eine Frau in mittleren Jahren kommt auf uns zu. Sie schreit unverständliche Worte, hält sich den Magen und schaut gegen den Himmel. Dann streckt sie uns ihre bettelnde Hand hin. Da wir kein Geld bei uns haben, können wir ihr nichts geben. Sie wiederholt dieselbe Szene. Zwischen zwei Sätzen spuckt sie auf den Boden. Nachdem wir uns nicht verständigen können, müssen wir sie halt stehen lassen.
Wir kommen durch eine Straße, wo junge Dattelpalmen in geordneter Reihe gepflanzt sind. Sie wachsen hier ohne Wasser? Es ist das erste Mal, dass wir Dattelpalmen sehen. Sie sind sehr schön. Ihr Stamm besteht aus lauter abgeschnittenen Blättern. Nachher am Rand vom Meer sehen wir noch andere große Dattelpalmen, die tatsächlich Datteln tragen.
Die Straßen sind mit kleinen runden Steinen bepflastert. Hie und da kommt ein Fahrrad vorbei. Autos haben diese armen Leute nicht. Wir sehen nur braunhäutige aber nicht einen weißhäutigen Menschen. Eine dürre graue Ziege läuft über die Straße. Vor uns geht eine Frau. Sie hat einen Korb um den Arm hängen, darin sind Mangofrüchte. Sie isst eine um die andere. Dabei wirft sie die Haut auf die Straße, und wenn alles gelbe Fleisch um den flachen Stein herum abgegessen ist, dann nimmt dieser denselben Weg wie die Haut.
Schwarze Wolken ziehen sich am Himmel zusammen. Wir treten den Heimweg an - dem Hafen zu. Ein starker Wind erhebt sich
Seite 33
und wir gehen schneller, einen plötzlichen Regenguss fürchtend. Drei Tropfen fallen mir auf den Arm und wir denken "jetzt geht's los" und gehen noch schneller. Wir hätten aber ruhig langsam heim laufen können, denn als wir am Schiff ankommen, war kein weiterer Tropfen gefallen und man sagt uns: "Dies war der große Regen. Hier regnet es nie."
Die herumlungernden Neugierigen, die auf dem Kai standen, als wir fortgingen, stehen immer noch da und noch neue dazu. Sie bilden eine dichte Mauer und weichen nicht vom Fleck. Jede unserer Gesten wird überwacht. Sie schreien und lachen und spucken dabei ins Meer, setzen sich, stehen wieder auf und beugen sich vor, wenn die Küchentür aufgeht.
Auf dem Deck können wir unter diesen Umständen nicht mehr essen oder schlafen wie vorher, sondern wir müssen dies jetzt unten tun, wo's keinen Durchzug gibt und die Hitze schwer zu ertragen ist. Unser Schiff ist ja für kalte und nicht für heiße Meere gebaut, und es gibt viel Platz für die Fische und nur wenig für die Mannschaft. Es ist klar, dass wir hier am Hafendamm nicht ausruhen können. Am Anker weit vom Kai waren wir ganz für uns und unbehelligt.
Die kapverdischen Inseln haben aber die Besonderheit, dass es viel Wind gibt. Nicht einen regelmäßig blasenden und erfrischenden Wind, sondern wenn alles ruhig ist, erhebt sich plötzlich ein brutaler Wind, der mit heulendem Ungestüm alles fortbläst und das Meer heftig in Unruhe bringt. Dies dauert nur einige Minuten, manchmal nur Sekunden, dann ist alles wieder stille. So ist es Tag und Nacht. Der Wind kommt angebraust, er legt sich wieder, wie es ihm behagt. Kann da ein Schifflein am Anker festhalten, wenn noch dazu der Meeresgrund schlammig ist? Vor diesem Problem stehen wir jetzt.
Mit der untergehenden Sonne verschwanden auch unsere Gaffer.
Dafür kamen dann etwas später Autos, diesmal mit Weißhäutigen, die stracks vor unserem Schiff anhielten, uns in ihr Scheinwerferlicht tauchten und lange Zeit uns und unser Schiff betrachteten. Oft stiegen die Männer aus, gingen langsam dem Schiff entlang, alles haarscharf und mit dem größten Interesse und forschendem Auge untersuchend, während ihre Frauen im Auto sitzen blieben. Wir sind hier der Mittelpunkt der Sehenswürdigkeiten geworden, wir, die wir gerne still für uns leben.
Seite 34
Mit der aufgehenden Sonne fing auch das "Gaffen" wieder an.
Zuerst einzelne, dann mehr und mehr. Wir mussten es uns wohl oder übel gefallen lassen. Aber eines stand fest: wenn wir das Schiff mit Rohöl gefüllt haben, dann ruhen wir uns noch ein paar Tage am Anker aus. - Und der Tag kam, wo wir trotz des gefährlichen Windes vom Hafen weg in die Bucht fuhren, wo noch andere Schiffe vor Anker lagen. Dort warfen wir zuerst den Anker aus der Bretagne hinaus, dann noch den, welchen wir in Las Palmas mit dem unseren zusammen vom Meer heraufgezogen haben und - sie hielten. Dankbar und glücklich erkannten wir, dass dieser Ankerfund kein Zufall war.
Wir sind jetzt der Stadt viel näher gerückt. Deutlich können wir alle Häuser erkennen. Ein sehr schönes, buntes Bild. Wenn wir zurückblicken übers Heck, sehen wir nicht weit von uns ein großes schwarzes Schiff. Dieses Schiff war einmal ein sehr schönes Segelschiff. Es ist vielleicht dreißig Meter lang. Sein elegant zugespitzter Vordersteven blickt stolz ins Meer hinaus. Unter dem oberen Rand steht weiß auf schwarz sein Name: "Senhor de Alieas". Wie nieder und klein sind wir neben diesem Eindruck erweckenden einstigen Prachtschiff. Wie schön muss es gewesen sein, als es anno dazumal mit vollen Segeln in See ging. Das muss man den Portugiesen lassen, dass sie einmal große Säemänner gewesen sind.
Heute nun hat dieses schwarze Schiff, das neben uns vor Anker liegt, keinen Masten mehr und ein paar Vagabunden wohnen darin. Einer muss dabei sein, ein Essen zusammenzubrauen, denn aus einem krummen rostigen Blechrohr, das wohl Kamin genannt werden kann, entsteigt ein schwarzer Rauch. Jetzt kommt er auf die Reling
Seite 35
zu und beugt sich darüber, und nach mehrmaligem versuchen gelingt es ihm endlich, mit einer langen Schnur etwas Meerwasser herauf zu ziehen, an deren Ende er eine leere Konservendose gebunden hat.
Da es in allen Dingen Vor- und Nachteile gibt, müssen wir jetzt, wenn wir in die Stadt wollen, mit unserem Boot bis ans Land fahren. Wir haben aber nur ein leichtes Plastikboot, und dieses geht nur mit großer Mühe vorwärts, wenn der Wind so stark ins Meer bläst wie hier. Deshalb winken wir zwei rudernde Männer her, die in einem kräftigen Holzboot sitzen und mit zwei langen Rudern schnell vorwärts kommen. Jeder von ihnen bedient nur ein Ruder, umschlossen mit beiden Händen. Diese Männer sind sehr froh, dass sie etwas Geld verdienen können; einer spricht auch ein wenig englisch, und sie haben uns bis zur letzten Stunde unseres Aufenthalts auf "Cabo Verde" treu und pünktlich an Land und wieder zum Schiff geführt.
Um drei Uhr heute Nachmittag sind unsere bestellten Ruderer da.
Wir erkannten sie schon von weitem, denn einer von ihnen trägt stets ein und denselben hellgelben Pullover. Mit unterwürfiger Höflichkeit werden wir behandelt. Der Gelbbekleidete, welcher der Chef zu sein scheint, hat immer ein breites Lachen für uns, obwohl ihm die Hälfte seiner Schneidezähne fehlen. Viel schneller als mit unserem Plastikboot kommen wir am Land an. Die beiden Männer haben kein Wort miteinander gesprochen. Rudern ist anstrengend.
Vom Hafen aus gehen wir durch das Zentrum der Stadt. Hier halten wir uns nicht länger auf, denn wir wollen uns das Armenviertel ansehen.
Gehwege gibt es hier keine, nur staubige Erde in roter Farbe. Die Häuser sehen sich alle gleich. Sie sind ebenso rot wie die Erde, weil sie aus derselben gebaut sind. Sie sind nieder, haben nur eine Türe und ein Fenster, besser gesagt eine rechteckige Öffnung ohne Scheibe, auf derselben Seite wie die Tür. Straßen gibt es eigentlich hier keine mehr. Unregelmäßig steht da und dort ein Haus, manche sind zusammengebaut. Die Gegend ist bergig. Weiter oben stehen noch primitivere Hütten, nur noch aus Wellblech.
Wie froh sind wir, dass wir bis hierher gegangen sind. So etwas werden wir wohl nicht mehr sehen. Eintönig, trocken und staubig ist diese Gegend, einzigartig und unübertrefflich rudimentär, aber dadurch ganz besonders malerisch.
Seite 36
Ein schöner grauer Esel steht unbeweglich im Schatten einer Hauswand. Etwas weiter hängen Wäschestücke zum trocknen an einer Mauer. Jedes Stück ist oben mit einem Stein beschwert. An der Ecke eines Hauses sitzt eine Frau auf der Erde, umgeben von vielen Kindern, die fast oder überhaupt nicht bekleidet sind.
Wir gehen den Berg wieder hinunter. Ein kleines Mädchen sitzt vor einem Haus auf dem Boden. Es spielt mit Steinen. Schöne viereckige Fächer hat es auf die rote Erde gezeichnet. Dies ist ihr Kaufladen . . . ein Häuflein großer Steine, ein Häuflein kleiner Steine, eines mit ganz kleinen Steinen...
Ehe wir im Zentrum der Stadt ankommen, ruft uns ein Mann auf französisch "bonjour" zu. Vor zwei Tagen erst lernten wir ihn im Hafen kennen. Dort hat er ein kleines Schiff. Er sitzt auf einem Stuhl vor einem Haus, das die gleiche Farbe hat wie die Erde und sagt: "Dies ist mein Haus, kommt herein!" Aus reiner Neugierde, wie es wohl im Innern dieser Häuser aussieht, treten wir ein. Eine alte Frau stellt er uns als seine Mutter vor, die heute ihren einhundertzehnten Geburtstag feiern würde! Er fragt, ob wir etwas trinken wollen. "ja, bitte ein Glas Wasser." Dieses bringt mir sogleich die alte Frau in einem schönen Glas. Dabei blickt sie mir auf die Füße und bewundert meine silbernen Sandalen, die ich mir in Las Palmas gekauft habe. Dies erfuhren wir durch die Übersetzung des Sohnes.
Seite 37
Das Innere des Hauses besteht nur aus einem einzigen Raum. Darinnen stehen zwei Betten, eines an der linken und eines an der hinteren Wand Dazwischen ist Platz für eine kleine Bank und zwei Stühle, auf denen wir sitzen, und noch für eine alte Kommode. Oberhalb dieser ist die kahle Wand mit Fotografien geschmückt. Rechts von dem zweiten Bett geht eine Stufe hinunter in einen kleinen offenen Raum, der wohl zum Kochen dient, denn von da herauf brachte die Frau das Wasser.
Der Mann nimmt eine Fotografie von der Wand und zeigt sie uns mit den Worten: "Das ist meine Frau. Sie ist in Argentinien." Er lacht dabei, wie wenn ihm dies eine Freude wäre. Dann holt er einen Zettel und einen Bleistift aus der Kommoden-Schublade. Er reicht beides Flore und sagt: "Schreib' mir deine Adresse darauf!" Ich sage ihr leise auf deutsch: "Schreibe nur deinen Vornamen darauf." Ich würge mein Wasser vollends hinunter. Es ist warm und hat einen gar sonderbaren Geschmack. Dann stehen wir auf. Die Hitze wurde unerträglich in dem Haus, nachdem Tür und Fenster auf derselben Seite sind und somit kein Lüftchen durchwehen kann. Mit Dank und Händedruck gehen wir so schnell wie möglich fort.
Der Mann steht unter dem Hauseingang mit dem Zettel in der Hand und liest "Flore" und laut rufend setzt er noch ein "Cherie" dazu.
Wir gehen noch schnell auf den Markt bevor er schließt. Dadurch ziehen wir noch mehr neugierige Blicke auf uns, denn die Einwohner dieses Landes gehen alle langsamen Schrittes. Warum auch eilen? Sie haben nichts zu tun. Und diese Hitze!
Bald sind wir am schwarzen Eisentor des Marktes angelangt. Im Innern führen links und rechts breite Treppen in den ersten Stock. Gemüse und Früchte sind kümmerlieh und haben einen tropischen Charakter. Sie kommen alle von der Nachbarinsel. Ärmlich hat jeder seine Siebensachen auf einem kleinen Tischchen oder auf dem Boden liegen. Die Auswahl ist sehr gering. Man findet kleine Kokosnüsse und Bananen, Mango Früchte, Mais, winzige Quitten, ein paar Salatblätter, und vor allen Dingen viele trockene Bohnen. Ein Sack steht neben dem andern. Sie alle enthalten Bohnen in den verschiedensten Farben. Es gibt gesprenkelte und einfarbige, und solche mit weißem Rand. Jede Art ist für sich in einem Sack. Ah, diese Farben! Welch schöner Anblick
Seite 38
Es gibt nicht eine Farbe, die nicht zu der andern passt, alle sind wunderbar aufeinander abgetönt. Hier ist das Land der trockenen Bohnen. Flore kauft von jeder Farbe einen kleinen Becher voll. Sie will ein Klebebild daraus machen, "die untergehende Sonne auf den kapverdischen Inseln." Und die Farben dieser Bohnen werden uns genau an die Farben und die Stimmung dies es Landes erinnern.
Pünktlich um halb sechs Uhr läutet eine Glocke. Wir bezahlen den letzten Becher und verlassen das Markthaus. Ein Mann steht am eisernen Tor und lässt niemand mehr herein. Wir gehen zum Hafen, der nicht weit entfernt ist.
Heute Morgen steht ein graues Kriegsschiff am Eingang des Hafens. Es ist so groß, dass es den Hafeneingang versperrt. So sieht es wenigstens aus. Mit dem Fernglas schauen wir zu ihm hinüber. Es gibt wirklich etwas zu sehen, denn noch nie sahen wir so ein großes Schiff. Es muss gerade angekommen sein. Jetzt ziehen sie ihre Flagge hoch, die außergewöhnlich groß ist. Es ist ein amerikanisches Schiff, ein Kreuzer.
Seite 39
Auf Steuerbord lassen sie ein Motorboot herunter, das mit ein paar weißgekleideten Männern besetzt war. Darnach ein zweites Boot mit blau gekleideten Männern. Diese beiden Boote kreisen nun unentwegt um ihr Riesenschiff herum, ohne Zweifel zur Bewachung.
Bald können wir sehen, dass es zum Brennstoffkaufen hierher gekommen ist, denn einer der Rohölkähne, die sonst in der Hafenbucht liegen, steht neben ihm. Er wurde dorthin geschleppt. Er selbst hat keinen Motor zum Fahren, nur einen Dampfmotor um die Pumpe in Bewegung zu setzen, welche den Brennstoff in das neben ihm liegende Schiff hineinpumpt. Dabei lässt er einen dicken schwarzen Rauch von sich, so dass auch der schöne Kreuzer daneben allmählich hässlich schwarz wird.
Während der erste Kahn sich entleert, wird ein anderer, voller, neben ihn geschleppt. Dadurch wird keine Zeit verloren, denn dieser zweite kann sofort angeschlossen werden, wenn die Reihe an ihm ist. Sobald der erste leer ist, wird er ans Ufer geschleppt, wo die großen Brennstoff Behälter stehen, die von Zeit zu Zeit von einem großen Tanker nachgefüllt werden. Der Schlepper nimmt einen dritten vollen Kahn mit auf dem Rückweg zum Kreuzer und schleppt dann den zweiten leeren bis zum Ufer. Ganz zuletzt werden die neugefüllten Kähne vom Ufer aus an den alten Platz in die Hafenbucht zurückgeschleppt. Dort warten sie auf das nächste Schiff.
Hoch auf dem Kreuzer sind viele große und komplizierte Antennen für verschiedene Radare angebracht. Einige dienen zum fahren und zur Beobachtung anderer Schiffe, andere zur Kontrolle ihrer Raketen und zur Beobachtung anderer Raketen und Flugzeuge. Ganz vorn auf dem Deck befindet sich die Raketenrampe.
Eines ihrer Boote fährt nun in unsere Bucht herein. Es nimmt den Kurs geradewegs auf uns zu. Wir stehen still und warten, was da kommen soll. Im Boot sind hohe Offiziere aufrecht stehend, ein Matrose bedient das Steuer. Sie fahren bis auf zwei Meter Abstand an uns heran, steuern dann langsam um den Vordersteven herum. Auf der andern Seite ankommend, lachen sie freundlich zu uns her und erheben die rechte Hand zum Gruß. Wir tun genau dasselbe. Alles ist in tiefer Stille geschehen, ohne dass ein Wort gesprochen wurde. - Das ist die selbstverständliche Zusammengehörigkeit im Meer.
Seite 40
Wir vermuten, dass sie an Land gehen. So ist es aber nicht. Sie fahren in weitem Bogen nach rechts und nehmen wieder Kurs zu ihrem Schiff. Sie haben nur eine Spazierfahrt gemacht in der Bucht.
Sobald die Brennstoff-Übernahme beendet ist, verlässt auch der Kreuzer von Porto Grande wieder den Hafen.
Noch einmal gehen wir in die Stadt, bevor wir in See stechen. Sowie wir am Ende des Kais ankommen, werden wir von bettelnden Kindern umringt. Am Anfang hatten wir sehr Mitleid mit ihnen, aber jetzt nach einer Woche sind wir fast immun gegen dieses bettelnde Volk, denn beinahe jeder bettelt. Es genügt, dass einer eine weiße Haut hat und anständig angezogen ist, so wird er regelrecht verfolgt von einem Ende der Stadt zum andern. Wenn wir jedem geben wollten, dann müssten wir selbst bettelarm und bloß dieses Land verlassen. Einmal wollte sogar einer einen Lumpen, einen einstigen Pullover, um ihn anzuziehen, an dem wir nur unsere meerwassernassen Hände abtrockneten. Dies hatten wir nicht für möglich gehalten. - Kein Wunder, sieht man nie weißhäutige Kapverdier. Diese werden wohl nur im Auto durch die Stadt fahren.
Auf dem Markt kaufen wir unter anderem auch Bananen zum gleich essen - eine grüne Bananentraube zum mitnehmen kaufen wir dann ganz zuletzt. Sie sind im Erdgeschoß rings herum an Balken aufgehängt. Wir gehen zu einem jungen Braunen, der hinter einem kleinen Ladentisch steht, welcher zugleich ein Fach bildet, in dem karaibische Jamswurzeln liegen. Schwer können wir uns mit ihm verständigen. Wir können nur auf spanisch "diez kilos" sagen, indem wir auf die Bananen deuten. Mit den Händen nachhelfend, versteht er uns endlich und sehr umständlich schafft er unsere gewünschten 10 kg grüne Bananen herbei.
Seite 41
AIs es dann ans Zahlen geht und ihm die Geldstücke in der Hand klimpern, beugt sich plötzlich ein anderer alter Brauner darüber und schreit den Jungen an, indem er auf das Geld deutet. Der Angefauchte schreit zurück, und so geht es hin und her während einiger Minuten, bis wir dann endlich unser Kleingeld zurückbekommen und abziehen können. Um was es sich dabei gehandelt hat, werden wir wohl nie erfahren. Beim Zurückblicken sehen wir, dass der Alte neben dem Jungen steht und gemütlich eine Banane verdrückt. Anscheinend haben sie sich wieder versöhnt.
In der Zwischenzeit haben wir Durst bekommen. Solchen Durst, dass uns die Zunge am Gaumen klebt. Gerade neben dem Markt ist ein Café. Da treten wir ein, um ein Coca-Cola zu trinken. Ausnahmsweise sitzen viele Weiße um die runden Tische. Diese sind aber keine Bewohner des Landes, sondern Matrosen, die zu einem großen Schiff gehören, das heute Morgen von Brasilien kam. Auf dem Bar Tisch steht ein tragbares Radio. Ein portugiesischer Sänger schreit mit großer Lautstärke ein abgedroschenes Lied um das andere heraus. Links neben der Tür liegt breit ausgestreckt ein deutscher Schäferhund. Wie wirkt wohl dieses Geplärr auf seine scharfen Ohren? Er wird es wahrscheinlich gewohnt sein. Vielleicht hat er eine innere Klappe zugemacht?
Die brasilianischen Matrosen bekommen Mokka serviert in kleinen Tässchen. Langsam und andächtig verrühren sie ihren Zucker. Hinter ihnen kommt gleich die Wand und da ist ein Ausgang. Die Tür geht nur bis zur Mitte und ist aus Latten, damit der Wind durchblasen kann. Die obere Hälfte besteht aus einem bunten Vorhang. Dieser ist rund aufgeblasen wie ein Segel durch den vom Hof kommenden Wind. Der schläfrige Hund neben uns erhebt sich langsam und mit Mühe. Gähnend schleppt er sich in die gegenüberliegende Ecke bis zur Türe, wo's zieht. Dort lässt er sich aufs neue auf den Boden fallen.
Die Bedienung kommt auf uns zu, eine dunkelhäutige Portugiesin. Ihr buntes kurzes Kleid klebt ihr am Körper. Mit einem breiten Lachen gießt sie uns aus einer Konservendose eine gelbe Flüssigkeit in die Gläser. Wir bezahlen gleich. Nachdem wir uns erfrischt haben an dem kühlenden Trank, suchen wir das Weite. Wir haben genau so viel bezahlt, wie wenn wir ihn auf der Champs Elysées in Paris getrunken hätten.
Seite 42
19. August
Heute, Montag, verlassen wir den Hafen von Porto Grande. Unsere Anker haben festgehalten. Die Häuser, der Kai, verschwinden. Nun kommen wir an den kahlen, steilen Bergen vorbei. Auch sie verschwinden langsam. Ihre höchste Spitze steckt in schwarzen Wolken. Das Meer ist stille, der Himmel immer blauer, je weiter wir hinauskommen. Wir sind sehr froh an dem Dach aus Segeltuch, das wir hier gekauft haben. So haben wir Schatten auf dem Deck.
Zu unserer Rechten tauchen die hohen Berge der Insel Santo Antao auf. Im Westen der südlichen Hügelkette befindet sich die Spitze, die am höchsten ist. Sie heißt „Tope de Coroa“ (1979 Meter). Auch sie ist versteckt hinter den Wolken. Das ist die Insel, wo's regnet und grünt. Es muss sicher schön sein dort. Wir können leider nur graue Umrisse von weitem sehen.
21. August
Ein Fisch beißt in unseren Angelhaken. Welch wunderschönes Tier! Silberner als das schönste Silber. Beinahe zu schade zum Essen.
Unzählige Delphine begleiten uns lange Zeit links und rechts. Sie sind ganz nahe da. Man kann annehmen, dass sie die Gesellschaft eines kleinen Schiffes lieben. Mitunter schnellen sie ganz aus dem Wasser heraus. Auf deutsch werden sie ja auch Tümmler genannt. Sie sind für uns eine heitere Begleitung und bringen Abwechslung in den stets gleichen Anblick des Meeres.
23. August
Heute Morgen ist der Himmel ganz grau. Ray zeigt uns einen großen Fisch, der uns verfolgt. Manchmal ist er seiner ganzen Länge nach oberhalb des Wassers.
Seite 43
Gegen Mittag hat sich die Sonne noch nicht gezeigt, es regnet. Der große Fisch, der hinter uns war, ist jetzt vorn mit einem andern. Es sind Meerschweine, gut zwei Meter lang. Sie bleiben dicht neben dem Vordersteven. Einmal sind sie links, einmal rechts, gleich unter dem Meeresspiegel. Man sieht sie gut, denn ihre braungrüne Farbe sticht scharf ab vom tiefen Blau des Ozeans. Wenn eine Welle höher hinaufgeht als sie, dann schnellen sie zur Hälfte aus dem Wasser heraus.
Gegen Mitternacht wird es sehr schwül. Weit am Horizont sieht man bisweilen Blitze aufleuchten.
24. August
Herrlicher Sonnenaufgang blau und rosa über dem ganzen Himmelszelt. Dann taucht etwas gelb und orange auf in den zartesten Farben.
Schon morgens ist es sehr warm. Wir sind jetzt genau unter dem Zenit. Die Sonne steht steil am Himmel. Das Meer ist glatt. Die Dünung kommt und geht langsam. Es sind zweierlei Bewegungen im Meer. Hier ist ein Gegenstrom. Ohne unser Segeltuch-Dach könnten wir's schwer aushalten. Wir sind alle im Badeanzug. Mittels eines Eimers an einer Schnur holen wir das warme und tadellos saubere Meerwasser herauf und leeren es uns über den Kopf, so oft wir wollen.
25. August
In der vergangenen Nacht gab es einen plötzlichen Regenguss, aber der Wind und das Meer haben sich bald wieder beruhigt.
Heute ist Sonntag. Um sieben Uhr heute Morgen hat ein Thunfisch, in den südlichen Meeren auch „Bonite“
+++ genannt, angebissen. Was für ein schönes Tier! Schwarzblau auf dem Rücken, hell leuchtend silbern auf dem Bauch. Darüber ziehen sich seiner ganzen Länge nach bunte Streifen wie Regenbogen. Mitten auf dem Bauch hat er einen grünen Fleck, der sich in ein leuchtendes Gold verwandelte, als die Sonne drauf schien. Ein märchenhaft schönes Tier. Welch verschwenderischen Reichtum an Schönheit hat der Schöpfer hier bei Tieren angewandt, die niemand sieht, die hier mitten im atlantischen Ozean leben, wo selten ein Schiff vorbeikommt; diese hat er mit den Farben des Himmels bei auf-oder untergehender Sonne versehen.
Seite 44
Gegen 10 Uhr sehen wir plötzlich weit im Meer ein hohes Bambusrohr. Ein kleines weißes Fähnchen flattert an seiner Spitze. Was kann das sein? Ray verlangt schnell sein Fernglas. Er war gerade dabei, das Besteck aufzumachen. Das Bambusrohr steht aufrecht im Meer und scheint in etwas Dunkles gespickt zu sein. Wir steuern darauf zu und können es mit der Hand erwischen, können es aber nicht heraufziehen, denn es ist festgebunden an ein Floß - eine große runde Kugel aus dunkelgrünem Glas. Von dem Floß aus geht eine lange Schnur ins Meer hinaus.
-- Ah! das ist ein „palangre“
+++ japanischer Herkunft.
Die Japaner fischen fast überall an den Küsten des atlantischen Ozeans und diesen palangre haben sie wohl verloren. Er ist von der Strömung, vermutlich von Dakar aus, 1200 Meilen in die offene See getrieben worden
.
27. August
Der Himmel ist grau, ab und zu leichter Regen. Delphine begleiten uns. Abends fangen wir wieder eine silberne Bonite.
Seite 45
28. August
Heute ist wieder ein sehr heißer Tag. Das Meer ist ziemlich stille.
Der Wind kommt von vorn, dadurch kommen wir etwas weniger schnell vorwärts.
Außer Meer und Himmel sehen wir nichts, nicht einmal eine Katze, wie man sagt. Seit wir unterwegs sind, jetzt neun Tage, haben wir noch kein Schiff gesehen. - Gerade während ich dies schreibe, tauchen plötzlich schwarze Vögel auf, die nicht weit von uns auf der Fischjagd sind. Eine Art Seemöwen. Sie kreisen eine Zeitlang um denselben Fleck, dann verschwinden sie wieder, wie sie gekommen sind.
Eine silberne Bonite hat im Moment angebissen. Dasselbe Tier wie gestern, nur etwas kleiner. - Wir haben immer eine fünfzig Meter lange Schnur mit einem Angelhaken und einer Lockspeise draußen hängen. - Nie kann ich die Schönheit, die Harmonie der Farben und der eleganten Form dieser Fische genug bewundern.
Dass Fischblut kalt sei, ist falsch. AIs wir ihm den Kopf abschnitten, quoll warmes Blut heraus, so rot wie das unsere. Auch beim Öffnen des Bauches fühlten wir, dass alle seine Organe warm sind. Sein abgeschnittenes Herz schlug noch auf unserer Hand. Sein Magen war voll von winzigen Fischen.
In drei Tagen kommen wir in Cayenne an. So Gott will und wir leben. Dies bedeutet das Ende unserer Seereise.
29. August
In der vergangenen Nacht fing der Wind stark zu blasen an.
Bald darauf regnete es viel. Je mehr der Wind blies, je mehr erhob sich das Meer, so dass es fest schaukelte. Keiner von uns hat viel geschlafen. - Die schwarzen Möwen waren auch wieder da. Sie umkreisten das Schiff. Jedesmal, wenn sie am Licht von Backbord oder von Steuerbord vorbeiflogen, stießen sie einen sehrillen Schrei aus.
Der Sturm, der Regen, das schlingernde Schiff, die kreischenden schwarzen Vögel hätten uns in eine ganz unheimliche Stimmung bringen können, wenn wir abergläubisch wären. Dem Aberglauben haben wir aber schon lange den Abschied gegeben, und so hatten wir keine Angst.
Mit der aufgehenden Sonne hat sich das Meer wieder beruhigt.
Seite 46
30. August
Immer noch schwarze Wolken und vereinzelte Regenfälle. Heute Nachmittag sehen wir endlich ein Schiff. Weit am Horizont zwei Masten.
Ray konnte heute Vormittag mit Radio Cayenne sprechen. Er bestellte einen Lotsen für Sonntagmorgen.
Das Wetter wird jetzt langsam schöner. Man sieht blauen Himmel hinter weißen Wolken.
31. August
Heute früh beim Morgengrauen sagt Ray: "Komme nach vorn und rieche, wie stark man hier die Erde riecht!" Und tatsächlich, ein herrlicher, lang entbehrter Geruch nach Erde beim Erwachen des Tages kommt uns entgegen. Wir tun tiefe Atemzüge. Unter dem Meeresspiegel sind viele Delphine. Sie schwimmen weg und schwimmen wieder her. Von Zeit zu Zeit strecken sie den Kopf aus dem Wasser, um zu atmen. Der ganze Leib, mit der Floßfeder zuoberst folgt dann nach, und in einem runden Bogen verschwinden sie wieder unter dem Wasser. Dort kann man sie auch noch zeitweise sehen. Die ganze Nacht waren sie bei uns und haben sich vergnügt ums Schiff herum. Wie schön ist es, ganz besonders bei Nacht, wenn sie die Wogen durchfurchen, lange weiße Streifen hinter sich lassend, so leuchtend wie unzählige kleine Sterne aneinander gekettet. Das kommt von dem Phosphor des Planktons, das sich durch ihr Schwimmen bewegt. Ein ganz feenhafter Anblick.
Der Himmel ist fast frei von Wolken. Die Sonne geht jetzt auf.
Am Horizont, dort wo man glaubt, dass der Himmel und das Meer sich berühren, steigen die ersten goldenen Strahlen herauf, wie aus dem Meer kommend. Schräg oder aufrecht zeichnen sie einen leuchtenden Halbkreis ins Himmelsgewölbe. Darunter blaues stilles Meer. Welches Bild! Mit Worten kann man solch eine Schönheit kaum beschreiben. Ein wunderschöner Tag erhebt sich, der letzte unserer Reise.
Gegen elf Uhr begegnen wir einem amerikanischen Fischerschiff. Sie fischen hier Krabben (Shrimps), die dann tiefgekühlt nach Amerika versandt werden. Das Meer hat jetzt eine grüne Farbe, ein grün-emeraud. Es gibt hier nicht viel Wassertiefe.
Seite 47
Um zwei Uhr nachmittags sehe ich Sylvia mit dem Fernglas nach vorn gehen. Dann ruft sie "Festland!" Ray wäre gerade etwas eingeschlafen. Schnell erhebt er sich, und tatsächlich sieht er weit am Horizont graue Umrisse. Links eine kleine Rundung, dann ein langer, flacher Streifen und rechts mehrere kleine Berge. Man muss ganz scharfe Augen haben, um das erkennen zu können. Nach den nautischen Instruktionen, ist das der Landungsplatz von Cayenne. Die kleine linke Rundung ist eine Insel, genannt „La Mère“ (die Mutter), die lange flache Hochebene heißt „Plateau de Mahury“, rechts ist der Berg „Bourda“ und die Insel „Le Père“ (der Vater).
Nach zwei Stunden ungefähr kann man hohe Bäume wahrnehmen. Je näher wir kommen, je besser sehen wir, dass diese Erde mit Grün überzogen ist. Dies ist sehr erquickend, wenn man von den kapverdischen Inseln kommt. Wie rund und formschön ist ein mit Bäumen bewachsener Berg gegen einen, der keinen Grashalm trägt. Bald können wir erkennen, dass keine Stelle ist, wo keine Pflanzen wachsen, sondern Baum steht neben Baum. Die majestätischen Kokospalmen sind höher als die andern, sie tragen ja ihre Blätter und ihre Früchte gegen den Himmel. Ein großes weißes Haus steht auf einem Berg, und viele kleinere und größere mit roten Dächern am Meer entlang. Mit dem Fernglas können wir eines nach dem andern in die Nähe herholen.
Das Meer hat jetzt eine hellbraune Farbe, denn der Meeresgrund ist schlammig, und weiter im Süden mündet der Amazonenstrom ins Meer. Dieser bringt durch die vom Süden kommende starke Strömung viel Erde und seinen ganzen Schlamm mit sich hierher. Er ist voll davon durch den gewaltigen Regen, der auf die neben ihm liegenden äquatorialen Länder niederstürzt.
Bald sehen wir rechts einen schwarzen Felsen, der einer Kirche ähnlich sieht. "L'enfant perdu" (das verlorene Kind) heißt er. Hier neben der Boje haben wir für den morgigen Sonntag um elf Uhr ein Treffen mit dem Lotsen ausgemacht.
Ein starker Wind erhebt sich plötzlich, und eine riesige Dünung formt sich im Meer. Der Abend ist nahe. Wir versuchen trotzdem hier zu ankern, damit wir einmal eine Nacht schlafen können. Leider müssen wir bald feststellen, dass der Anker in dem Schlamm und bei dem starken Wind nicht hält. Er reißt sich los mit einer Geschwindigkeit von eineinhalb Knoten. Enttäuschten Herzens ziehen wir den Anker wieder herauf.
Seite 48
Ray ruft nun Radio Cayenne an. Vielleicht kann der Lotse schon heute Abend kommen. Leider ist einer auf dem Posten, der von unserem Radio-Anruf vom Donnerstagmorgen nichts weiß. Er fragt uns nach der Telefonnummer des Lotsens. Der Mann hat keine Ahnung, dass es sich um ein Schifflein handelt, das aus Frankreich kommt. Nach langem hin und her versucht er dann, dem Lotsen zu telefonieren. Dieser ist leider nicht zu Hause. So bleibt uns nichts anderes übrig, als die ganze Nacht vor Cayenne in der Gegend des "verlorenen Kindes" auf und ab zu fahren. Den Leuchtturm dürfen wir nicht aus dem Gesicht verlieren, denn er ist unser Anhaltspunkt, um zu wissen, wo wir sind.
Das Meer ist so schlecht, dass wir fast nicht kochen können, auch mit dem schlafen ist es wieder nichts. Unsere Herzen sind traurig. So nahe am Ziel noch diese harte Geduldsprobe. Mir fällt die Geschichte der Juden ein, die siebenmal um Jericho herumgehen mussten, ehe die Mauern fielen. Sicher hat der Herr uns noch etwas zu sagen in dieser letzten Nacht unserer wunderbaren Reise: Busse über jeden bösen Gedanken, jedes ungeduldige Wort, damit wir würdig oder wenigstens dankbar so vieler Gnade und so vieler Bewahrung morgen unser neues Leben beginnen. Ray entblößt sein Haupt und betet mit uns.
Ungefähr eine Stunde nachher legt sich der Wind und beruhigt sich das Meer, so dass jeder von uns ein paar Stunden schlafen kann.
Guyana
Sonntag, 1. September 1968
Der Himmel ist blau heute morgen und das hellbraune Meer still. Manchmal kommt ein Stück Holz angeschwommen. Wir sind neben der Boje, nicht weit vom "verlorenen Kind" und warten auf den Lotsen. Zwanzig Minuten vor elf Uhr sehen wir ein Schnellboot vom Land wegfahren in unsere Richtung. Ray sagt: "Das kann nur der Lotse sein." Bald schaltet er seinen Scheinwerfer an, der oben vorne an seinem Schiff angebracht ist und wir verstehen, dass wir ihm entgegenfahren sollen.
Seite 49
Nach zehn bis fünfzehn Minuten ist er uns ganz nahe. Drei Männer von brauner Hautfarbe sind in dem Boot. Einer steht aufrecht auf Deck, nahe am Rand. Das ist der Lotse. Er wartet nur, bis wir Bord an Bord sind, und mit einem Satz ist er in unserem Schiff. Dabei wird das eiserne Schnellboot von der Dünung brutal gegen unser Schiff geworfen, dass es kracht. Wir sind verwundert, dass unsere "Perle" heil aus diesem Zusammenstoß hervorgeht. Sie hat anderes erlebt
Der Lotse ist jetzt mit Ray auf der Kommandobrücke und dirigiert die Fahrtrichtung. Man kann nur bei Flut in den Hafen einfahren. Bei Ebbe ist es nicht mehr tief genug. Es ist sehr gefährlich, in solch einen Hafen einzuschiffen, wenn man ihn nicht kennt, und es ist vorsichtiger, einen Lotsen zu bezahlen, als sich in letzter Minute aufs Trockene zu setzen. Jetzt kommen wir der Erde immer näher. Wie schön und sympathisch ist dieses Land. Mit höchstem Interesse beschauen wir alle Einzelheiten, denn hier wollen wir ja bleiben.
Seite 50
Häuser mit roten Dächern, schöne Bäume, Kokospalmen. Keine Wolkenkratzer. Nur rechts ist ein großes gelbes Haus. Scheint eine Kaserne zu sein.
Nach einer Stunde sehen wir den Hafen. Rechts daneben liegen in einer Bucht einzelne kleine Schiffe vor Anker. Sie haben einen besonderen Charakter. Die Form ist schön, und jedes hat ein Dach aus Segeltuch. Es sind brasilianische Schiffe "Tapouille" genannt. Bald ist es zwölf Uhr. Flore ruft mir zu: "Mutter, riechst du? Dieser Geruch erinnert mich an etwas." Es riecht nach Mittagessen von Eingeborenenart, nach Rauch, feuchter Waldluft, Schweiß und tropischen Blumen. Dies alles gemischt gibt einen köstlichen Geruch nach bewohnter Erde und Leben. Wir, die wir vom Meer kommen, sind nur noch die einseitige und gesalzene Luft gewohnt, die allerdings unserer Haut eine wunderschöne goldbraune Farbe gegeben hat. Natürlich nicht bloß die Luft, sondern auch der Meeresspiegel und die Sonne.
Nun kommen wir am Kai an und fahren an den Platz, den uns der Lotse, welcher zugleich Hafenmeister ist, anweist. Letzterer steigt nun wieder aus. Seine Arbeit ist beendet. Er hilft noch beim Vertäuen des Schiffes. Ein paar Männer stehen oben und schauen zu uns herunter. Auf der andern Seite des Kais liegt ein deutsches Schiff vor Anker mit dem Namen "Amazonas". Der Bootsmaat erzählte uns später, als wir angekommen seien, hätte er zu seinen Leuten gesagt: "Da schaut nur gut zu, wie diese Mädchen helfen beim Vertäuen des Schiffes und wie die hinlangen. Das sind Matrosen."
"Wisst ihr auch, dass wir jetzt in Südamerika sind", sagt eines der Kinder, "ich kann es noch kaum glauben, ich meine, ich träume". Kein Traum, echte, wahrste Realität: Diese alten Bäume, diese Kokospalmen, dieser blau emaillierte Himmel, diese Wärme, die brasilianischen Schiffe neben uns, und überhaupt diese Gestalten, die auf den Schiffen sind: der typische Südamerikaner, klein, schwarzbraun, schwarzhaarig, vertragene Kleider ohne Farbe, weil so oft schweißgetränkt und gebleicht von der Sonne, großer Strohhut, stets freundlich und bereit zu helfen, kurz: Seeleute.
Ray geht an Land, um Brot zu kaufen. Er kommt lange nicht mehr. Ein Monsieur F. hat ihn aufgehalten. Er hat hier im Hafen eine Krabben-Fabrik.
Seite 51
Um drei Uhr soll er wieder kommen, um uns mitzunehmen, 30 km ins Innere des Landes, zu einem Pflanzer.
Wir fahren durch Cayenne. Schweißgebadet betrachten wir uns die Stadt. Viele Häuser sind auf Pfahle gebaut. Rings um die Häuser herum sind Fensterläden, meistens geschlossen. Fensterscheiben gibt es keine, nur an den neueren Häusern manchmal. Die Dächer, meistens aus Wellblech, gehen weit über die Läden hinaus, um vor der Sonne und dem Regen zu schützen. Eine alte Stadt, Cayenne, die ihr besonderes koloniales Gesicht hat.
Als Monsieur F. Benzin kauft, steht an der Tankstelle ein Taxi, vollgedrückt mit echten Indianern, Männer und Kinder. Viel Charakter und Stolz steht auf ihrem Gesicht geschrieben. Man kann sie sogar schön nennen. Lange Haare stehen ihnen besser als kurze, sie sind von schöner schwarzer Farbe und ganz glatt. Ihr Kopf ist nahe bei den Schultern, denn sie haben nur einen kurzen Hals. Also diese "Wilden", welche anscheinend ihren Urwald nie verlassen, haben wir gleich am ersten Tag gesehen.
AIs wir dann aufs Land hinausfahren, erklärt uns Monsieur F., dass die ganze Gegend, die wir sehen, und die jetzt aus wildem Wald besteht, früher einmal bepflanzt gewesen sei. Heute muss alles eingeführt werden. Jeder pflanzt ein paar Bananenbäume für sich, und wer keinen Garten hat, muss unglaublich hohe Preise für Gemüse und Obst bezahlen. - Monsieur F. spricht ununterbrochen. Seine Stimme wirkt auf mich wie der Motor unseres Schiffes, denn Flore und ich sitzen hinten im Auto, und wir können nur die Hälfte verstehen von dem, was er sagt.
Die Pflanzer sind sehr liebe, gastfreundliche Leute. Sie zeigen uns ihre neugepflanzten Bäume, die sehr gut wachsen und bieten uns gleich erfrischende Getränke an. Ihr Haus steht oben auf einem Hügel. Ihr Wohnzimmer ist links und rechts ganz offen. Dies gibt einen wunderbaren Durchzug und einen herrlichen Ausblick. Hinter dem Haus sieht man in einem riesigen Käfig einen Affen. Außen herum spazieren braune Hühner. Etwas weiter sitzen zwei große Papageien, deren Federkleid alle Farben hat, auf einem Baum im Schatten. Es sind Ara. Sie sitzen unbeweglich da, obwohl sie ganz in Freiheit leben. Wenn sie Hunger haben, kommen sie ins Haus geflogen.
Die Zeit vergeht schnell, und wir müssen wieder fort. Gerne wäre ich noch etwas geblieben.
Seite 52
AIs wir zurückkommen, ist Nachtessenszeit. Monsieur F. bleibt als unser Gast an Bord. Am andern Morgen kommt er früh mit frischem Brot, das er für uns gekauft hat. Ray sagt ihm dann im Laufe des Tages, dass er ein Haus suche, wo er seine Familie und seine Möbel unterbringen kann. Monsieur F. erzählt ihm, dass er ein großes Haus habe auf dem Berg Bourda. Seine Frau und seine Kinder seien vor sechs Monaten nach Frankreich zurückgekehrt. Dieses Haus würde er uns zur Verfügung stellen, unter der Bedingung, dass wir ein Zimmer für seinen Bruder frei ließen, der von Frankreich kommen würde, um ihn zu ersetzen, denn er selbst müsse nach Frankreich zurück, um sich dort um den Verkauf der Krabben zu kümmern.
Haben wir richtig gehört? Wir können es kaum fassen, aber wir wissen: "Von dem Herrn ist es geschehen und ein Wunder vor unseren Augen." Wir haben wohl dem Herrn fest vertraut und geglaubt, dass Er uns nicht zuschanden werden lässt, wenn wir hier ankommen in diesem fremden Land. Ohne Vertrag, ohne sichere Anstellung, ohne genaue Kenntnis der Verhältnisse und des Klimas, ohne Empfehlung und ohne jemand zu kennen, denn wir haben dieses Unternehmen ja auch mit Ihm angefangen, wohl wissend, dass wir in vieler Augen als unsinnig gegolten haben. Aber der Herr hat uns nicht noch eine harte Probe auferlegt durch ein langes Warten im Hafen, sondern in Seiner Güte und Seiner Treue hat Er uns schon den Weg vorbereitet und uns schon am zweiten Tag nach unserer Ankunft eine Tür aufgetan, denn Er gibt über Bitten und Verstehen. Und gerade darin, wo wir Ihm vertraut haben, hat Er uns geehrt, denn die Zollbeamten und viele andere waren überzeugt, wie wir später erfahren haben, dass wir mit einem Vertrag hierher gekommen seien und dass wir Monsieur F. schon immer gekannt haben. So ist der HERR!
Nach zwei Tagen tut der Herr ein noch größeres oder ebenso großes Wunder für uns. Monsieur F. hat manchmal bei uns gegessen, und Ray hat sich nicht geschämt, vor dem Essen aus dem Herzen zu beten und zu danken. Ob es nun dieses ist, was Monsieur F. beeindruckte oder auch Ray's sonstiges Verhalten, immerhin ist es so, dass Monsieur F. so großes Vertrauen zu Ray gewann, dass er ihm die Direktion seiner Fabrik übergab, "denn" sagte er, "mein Bruder ist zu jung und nicht imstande dazu."
HERR, Anbetung Dir!
Seite 53
Heute, Donnerstag Morgen, den 5. September fangen wir an, unsere Möbel aus dem Schiff herauszubringen. Ehe wir das tun durften, verlangte der Zoll eine Adresse. (Wie wunderbar ist es, dass wir schon eine haben). Wir stellen drei brasilianische junge Männer an. Die Möbel von der Luke des Schiffes auf den Kai zu verladen, ist wirklich eine harte Arbeit, überhaupt bei Ebbe, wenn das Schiff drei bis vier Meter niederer ist als der Kai. Jedes Stück muss aus der Öffnung der Ladeluke, welche nur 1,30 X 1,30 Meter groß ist, herausgebracht, alsdann mit Seilen fest umbunden werden. Hernach wird der Haken der Talje (Flaschenzug), welche an der Spitze des Mastes festgebunden ist, in die Seile gesteckt, und ein anderer muss ziehen, bis das Möbelstück auf den Kai gehisst ist. Dann muss derjenige, welcher auf dem Kai steht, zuerst die Knoten und Seile wieder auflösen und Seile und Talje zusammen wieder zurückschicken. Jeder hilft mit, und diese Arbeit machen wir in der prallen Sonne ohne den geringsten Schatten. Das Thermometer im Steuerraum ist auf 34° C.
Ich muss die Brasilianer sehr bewundern. Ohne sich einen Moment Ruhe zu gönnen, arbeiten sie bei dieser Hitze. Der Schweiß läuft ihnen von den Haaren bis zum Hals, und an ihren Hemden ist keine trockene Stelle mehr. Man kann sagen, es laufen Brünnlein. Flore, die drunten in der Luke arbeitet, hat in ihrem Leben noch nie so geschwitzt. Sie muss sich oft bücken. Vom Kinn aus tropft es auf den Boden.
AIs dann das kleine Lastauto von Monsieur F. geladen ist, geht die Fahrt nach Bourda, vier Kilometer weit von Cayenne. Bei der zweiten Fahrt gehe ich und die zwei Kleinen, Veronique und Johelle mit. So können sie in dem Garten spielen.
Sowie die sehr fleißigen Brasilianer fertig sind mit Abladen so müssen sie hier alles noch viele Stufen den Berg hinauftragen.
Der kleine Lastwagen ist nun wieder fort, und ich bin allein in dieser neuen Umgebung. Wie fremd und einengend wirken diese Bäume und dieses Haus auf mich. 1ch bin bedrückt und traurig. Wie?
Seite 54
Sollte ich nicht mehr auf der Erde leben können? - Mein Blick fällt links hinunter. Dort glitzert es, nass-beweglich ... Du bist es, trautes Meer! 0, wie kann ich dich fühlen und verstehen, und wie weit bist du nun von mir entfernt. Nur noch zwischen zwei Bäumen darf ich ein kleines Stückchen von dir sehen, auch noch deine Brandung hören. Geliebtes Meer, "Perle des Vagues", ihr seid mir teuer geworden!
Unsere wunderbare Seereise ist nun zu Ende, und ich muss wieder leben wie ein gewöhnlicher Erdenmensch. "Herr Jesus, Du weißt es. Alles unter dem ganzen Himmel ist Dein, und Deine Gnade ist mir jeden Morgen neu, und meine Seele wird genesen."
E.E.B
Palangre
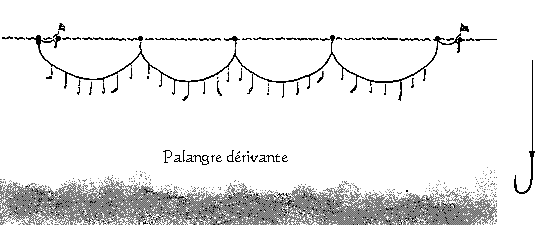
Bonite